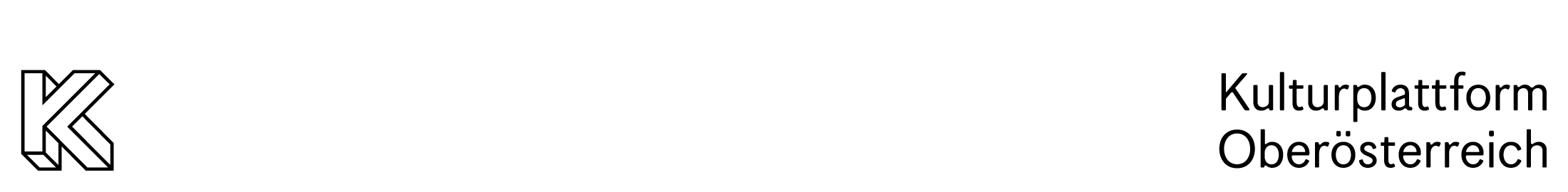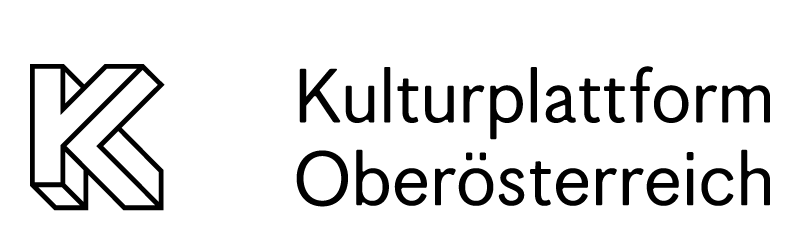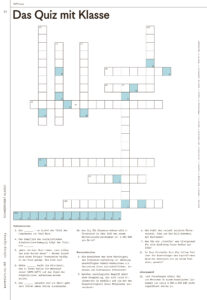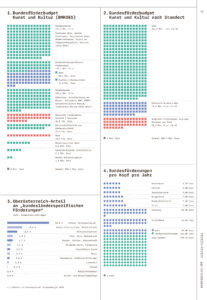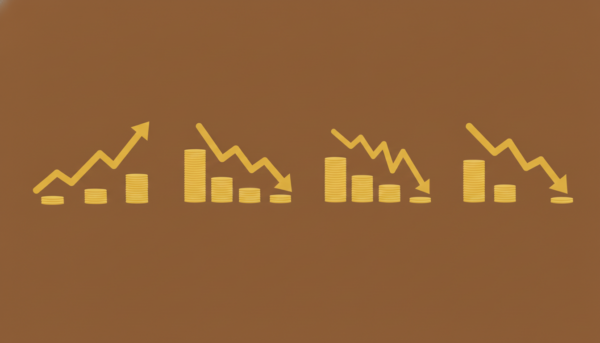Katherina Braschel über symbolisches Kapital im Kunst- und Kulturbereich
Es ist mittlerweile im Kulturbetrieb angekommen, dass auch über Klassenverhältnisse geredet werden muss. Die Frage ist allerdings, wer das wie darf. 2019 habe ich in meinen Dankesworten für den Rauriser Förderungspreis nicht nur Jury und Intendanz erwähnt, sondern auch die Reinigungskräfte des Hotels. Darauf bin ich danach auffallend oft angesprochen worden: so aufmerksam, so rücksichtsvoll.
Es fällt jemandem wie mir, die zuvor noch nie in einem derart luxuriösen Hotelzimmer übernachtet hatte, nicht schwer zu bemerken, wenn ein Mülleimer plötzlich leer ist. Denn dieses Bemerken geht mit einer gewissen Scham einher, dass da jemand für mich gearbeitet hat, etwas getan, was ich doch hätte selbst tun können. Weil ich plötzlich für drei Tage Teil einer sozialen Klasse war, der die Mülleimer ausgeleert werden, nicht einer, die die Mülleimer ausleert.
Aber: Ich bin auch Teil der Klasse, die über das kulturelle und symbolische Kapital verfügt, dies in einer Rede anzubringen. Weil ich zwar unter der Armutsgrenze und daher mit Margarine vom Discounter, aber in einem akademischen Haushalt mit Brecht-Reclam-Heften und Jelinek-Diskussionen aufgewachsen bin.
Künstler*innen wie ich wissen, wie man sich auf einer Vernissage verhält, was man über Kleidung mitteilt und welchen sprachlichen Ausdruck wir in einer Dankesrede verwenden (können). Dadurch kommt uns das Privileg zu, diese Normen brechen zu können und dafür meist auch noch Anerkennung zu bekommen. Denn wir haben genug unter Beweis gestellt, dass es eine bewusste (künstlerische) Entscheidung ist, wenn wir „Arschloch“ sagen oder in der Jogginghose zu einer Lesung kommen. Dass es ein Ausdruck ist und zwar nicht von unserem fehlenden symbolischen Kapital. Wir sind dann nicht „peinlich“, wir sind „kritisch“.
Deshalb wird uns auch zugehört, wenn wir über ökonomische Faktoren in der Kulturarbeit sprechen. Wir sagen vielleicht unbequeme Dinge, aber das Gegenüber muss keine Angst haben, dass es gleich unangenehm wird, weil es nichts mit dem „wie“ anfangen kann.
Und vielleicht machen wir uns damit öfter zu eh verträglichen Kompliz*innen als wir das intendieren.
Kulturelles und symbolisches Kapital
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu entwickelte die Theorie, dass Klassenunterschiede nicht nur auf ökonomischem Kapital, also finanziellem Vermögen, basieren, sondern auch auf sozialem, symbolischem und kulturellem Kapital. Kulturelles Kapital meint die vorhandene Bildung einer Person, symbolisches Kapital unter anderem das Wissen darum, wie man ersteres einsetzt und sich so einen Ruf macht oder erhält. Dazu gehören Sprachgebrauch ebenso wie körperliche Erscheinungsformen wie Kleidung.