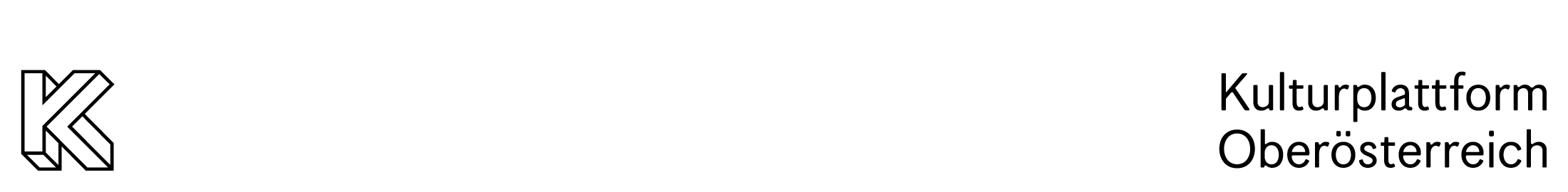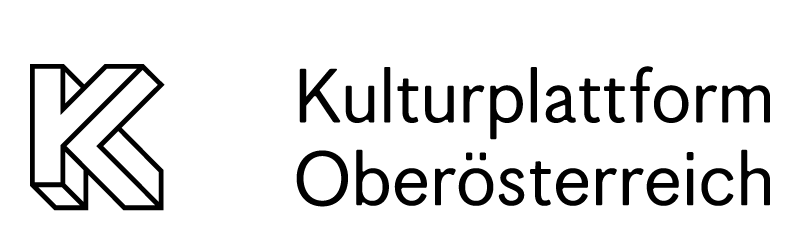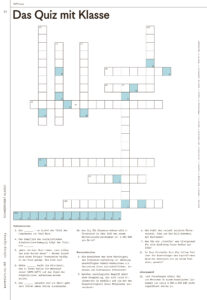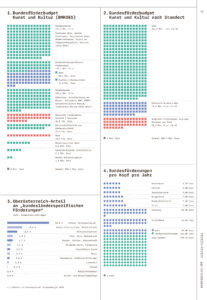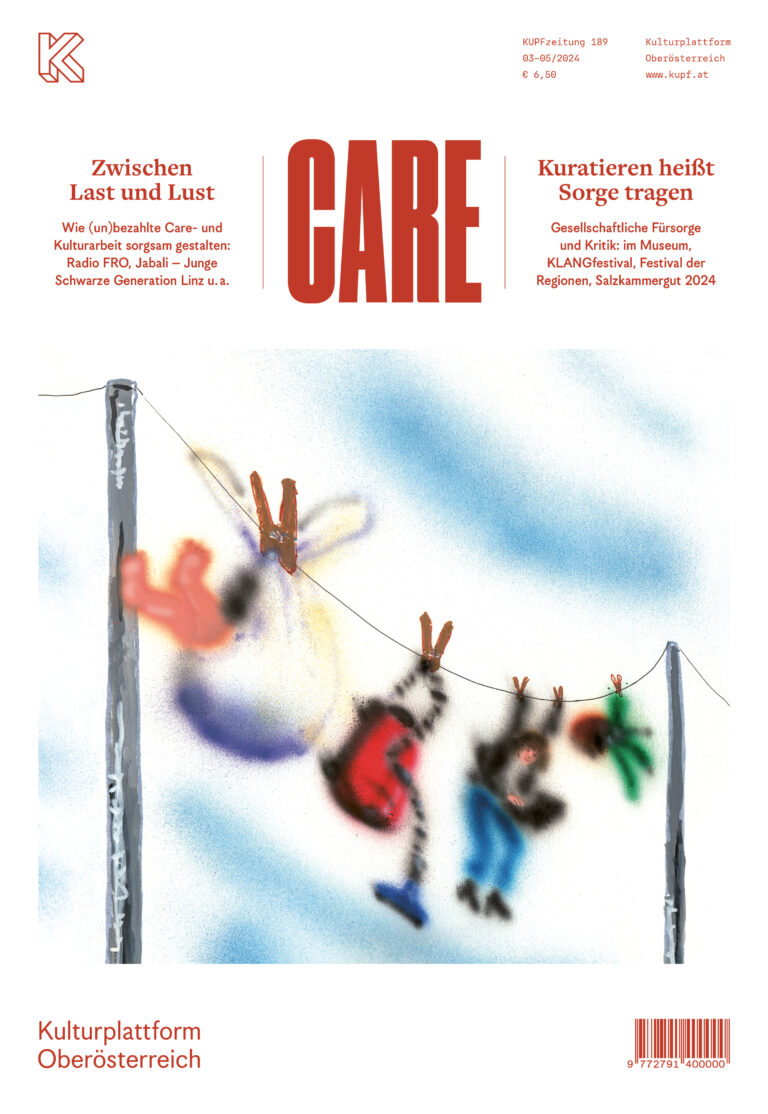Betina Aumair diskutiert den Zusammenhang von Sprache und sozialer Herkunft anhand von Sprichwörtern, Scham und Ausgelassenem.
Machtvolle Sprache
Es gibt Familien, in denen hauptsächlich in Sprichwörtern miteinander kommuniziert wird. Ich bin in so einer aufgewachsen. Die Lebensgefährtin meines Onkels verließ ihn wegen „eines anderen“, meine Oma sagte zu ihm zum Trost: Ein neuer Besen kehrt immer gut. Damit war alles gesagt und man konnte zum Mittagessen übergehen. Ein anderes Sprichwort, mit dem ich aufgewachsen bin, war: Wissen ist Macht. Das kam nicht aus meiner Familie, weil in ihr nicht Bildung zählte, sondern nur, wie müde man nach getaner Arbeit war. Heute weiß ich, dass nur bestimmtes Wissen Macht bedeutet, anderes Wissen wiederum gar nicht als Wissen anerkannt wird. Und dass Wissen alleine nicht reicht. Man muss es auch in die richtige Sprache bringen. Wissen, das in Leopardenleggins und goldenen Stiefletten daherkommt, besitzt in einem akademisch-bürgerlichen Umfeld keine Autorität. Außer vielleicht, das Outfit hat ein paar hundert EUR gekostet und ist fair trade. Der Soziologe Pierre Bourdieu sieht das auch so. Er schreibt, dass Menschen mit unterschiedlichen Graden von Autorität sprechen würden, dass Worte unterschiedliches Gewicht haben können, je nachdem, wer sie ausspricht und wie sie ausgesprochen werden und dass daher manche Worte in bestimmten Umständen eine Macht und eine Überzeugung bekommen würden, die sie sonst nicht hätten.
Beschämt durch Sprache
Sprache ist ein Instrument, das sowohl befreien als auch unterdrücken kann. Von der herrschenden Klasse wird sie bevorzugt als Werkzeug der Unterdrückung verwendet. Das bevorzugte Stilmittel dabei ist die Beschämung. Sighard Neckel, auch wieder ein Soziologe, schreibt über die Scham, dass sie ein soziales Gefühl sei, das im Alltag von Gesellschaften, in denen soziale Ungleichheit herrscht, beständig präsent sei. Neckel sagt auch, dass Scham immer sozial sei, weil sie sich auf Normen bezieht, die nur im sozialen Leben erzeugt werden, also im Verhältnis zu anderen.
Sprache ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sozialer Klassen. Das sagt auch die Soziologin Christine Goldberg, mit der Brigitte Theißl und ich für das Buch Klassenreise ein Interview geführt haben: „Die Sprache ist ein wichtiger Marker der sozialen Herkunft. Meine Herzenssprache ist der Dialekt, ihn selbstverständlich zu sprechen, habe ich mich nie so richtig getraut. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu finden, aber auch das hat mich verunsichert. Mir wurde auch immer vermittelt, dass ich nicht wirklich Hochdeutsch kann und der Dialekt immer durchdringt. In linksintellektuellen Kreisen ist die Sprache bzw. die sprachliche Gewandtheit sehr bedeutsam.“ Als ich Kind war, hatten wir in der Schule eine Stunde pro Woche ein Fach, das „Schön Sprechen“ hieß. Das hat bedeutet, dass wir in dieser Stunde hochdeutsch sprechen mussten, die restliche Woche durften wir wieder ‚schiach‘, also ‚normal‘ reden. Vor kurzem war ich in Kassel und habe einen Schreibworkshop zu Bildung und sozialer Herkunft für die Gewerkschaft geleitet. Ein Teilnehmer hat mich nach meinen ersten beiden Sätzen für mein gutes Deutsch gelobt. Weil er Türke war, habe ich das gleiche Kompliment erwidert. Wir haben uns beide sehr darüber amüsiert. Bemerkungen zur eigenen Sprache sind aber meistens nicht lustig, meistens sind sie herabwürdigend und fungieren als Platzanweiserinnen. In der Sprache wird die soziale Herkunft hörbar. Die Sprache, die verlangt wird, lässt eine*n Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit erfahren. Über Sprache wird diszipliniert. Im Studium bei einer Präsentation hatte ich auf der Folie „für was“ stehen. Ich wurde von der Professorin vor dem gesamten Hörsaal darauf aufmerksam gemacht, dass das keine korrekte Sprachanwendung sei, weil es „wofür“ heißen müsse. Ich allerdings hatte mir gedacht, dass „für was“ eh schon hochdeutsch sei, weil es im Dialekt ja „zu was“ heißt. Sonst weiß ich nicht mehr recht viel vom Studium.
Diskursive Auslassungen
Mit der Beschämung einher geht ein anderes beliebtes Stilmittel: die Auslassung. Das neoliberale Credo, dass jede*r alles schaffen könnte, wenn sich die Person nur ausreichend anstrengt, dass Österreich eine Leistungsgesellschaft sei, ist ein bequemer Weg, gesellschaftliche Verantwortung an Individuen abzugeben. Und gleichzeitig kann damit Ungleichheit legitimiert werden. Was dabei ausgelassen wird, ist, dass soziale Ungleichheit stabil, weil gewollt ist, dass sie strukturell und institutionell verankert ist und durch Ideologien wie die der Leistungsgesellschaft gerechtfertigt ist. Das Sprechen über klassenbezogene Diskriminierung ist schwierig, wenn verschwiegen bzw. verleugnet wird, dass wir in einer Erb- und somit Klassengesellschaft leben. Das hat auch zur Folge, dass es kein gesellschaftlich anerkanntes Vokabular für soziale Ausgrenzungserfahrungen und Beschämungen gibt.
Abgegrenzt
Der Ausgrenzung geht die Abgrenzung vorher. Vor allem im Kunst- und Kulturbereich gibt es ein enormes Abgrenzungsbestreben des Bildungsbürger*innentums. Es geht um den guten Geschmack, der in die bildungsbürgerliche Wiege gelegt wird. Demnach entscheidet auch das Bildungsbürger*innentum, was diesen ausmacht. Die Harlekinmasken aus Porzellan, die bei uns im Wohnzimmer hängen, weiß ich, gehören nicht dazu. Auch nicht Bücher von Donauland, selbst wenn es die Werke von Literaturnobelpreisträger*innen waren bzw. Ausschnitte aus deren Werken. Ich gehe gerne ins Kunsthistorische Museum in Wien. Ich mag den Detailreichtum der Bilder (da ist immer was los) und dass es kühl ist. In meiner Familie war das Bewertungsschema für Kunst: „schön“, „schiach“ und „das kann ich auch“. Recht viel differenzierter kann ich nach wie vor nicht über Kunst sprechen. Aber sprachliche Eloquenz ist ja auch kein Merkmal der Arbeiter*innenklasse.
In der Ausbildung, die ich mache, haben wir das letzte Mal eine Gruppenübung durchgeführt. Bei der Reflexion sagt eine Kommilitonin, dass B. und ich dieselbe Idee hatten, aber meinen Lösungsvorschlag niemand gehört habe, weil ich ihn nicht so eloquent ausgedrückt hätte wie B. Ich habe gesagt, wir könnten das Tuch „zaumschiam“, B. hat gesagt, „dass es aussehen soll, wie Farfalle“. Zumindest kann ich jetzt nach Spaghetti noch eine zweite Nudelform nach ihrem Aussehen benennen. Oder wie meine kluge Oma gesagt hätte: Ohne Dings kein Bums.
Lesetipps:
Betina Aumair und Brigitte Theißl, Klassenreise. Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, ÖGB 2020, 203 Seiten.
Pierre Bourdieu, Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches, nap 2015 [1982], 199 Seiten.
Sighard Neckel, Status und Scham. Zur symbolischen Repro duktion sozialer Un gleichheit, Campus 1991, 290 Seiten.