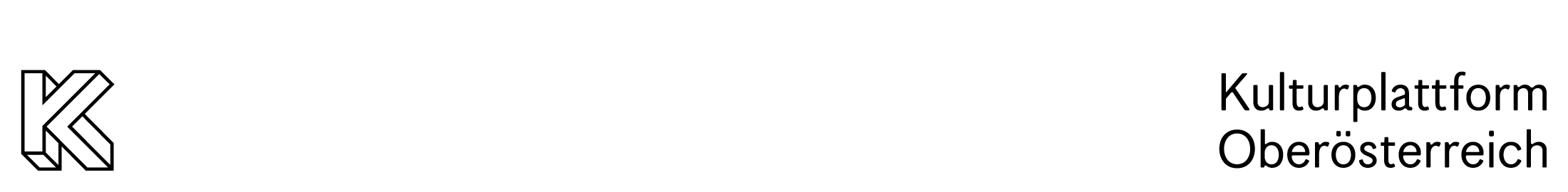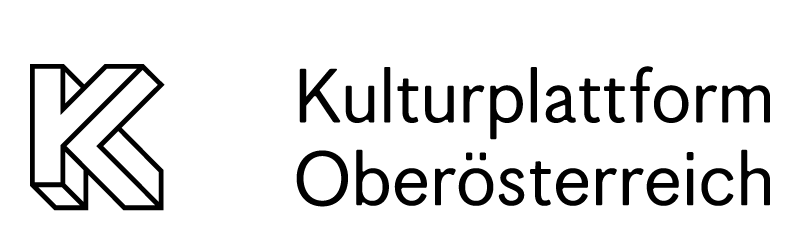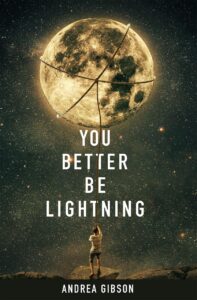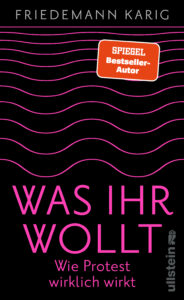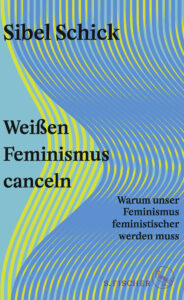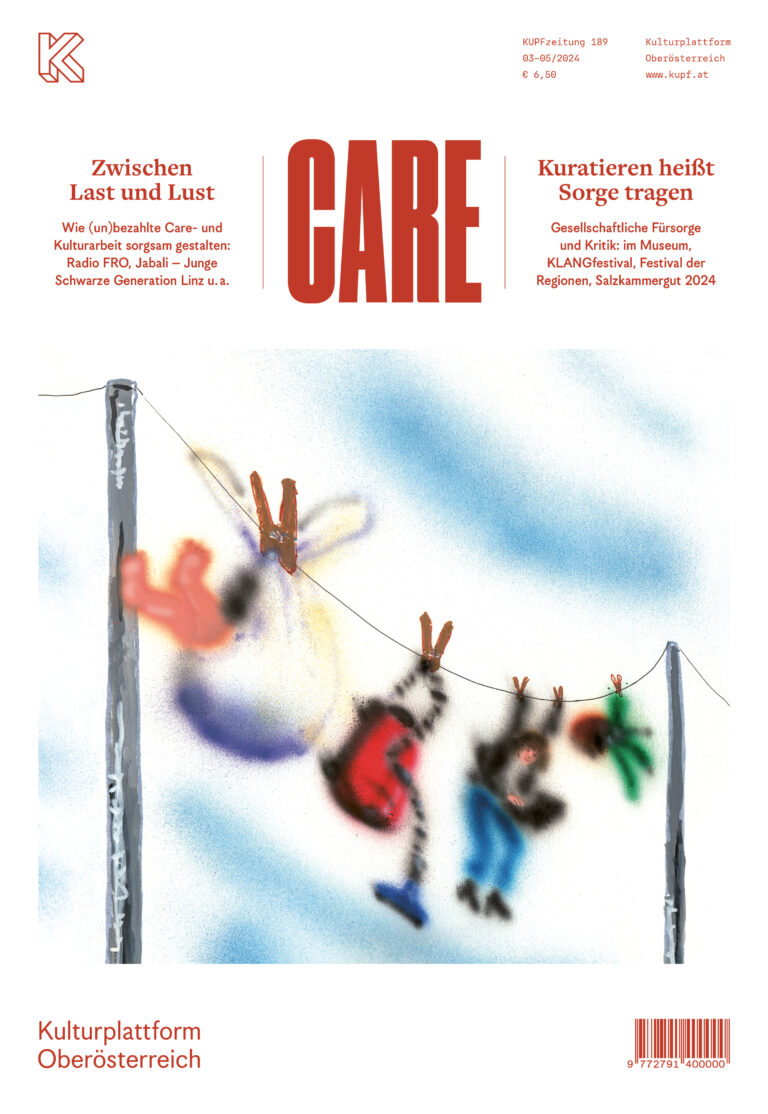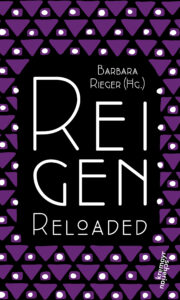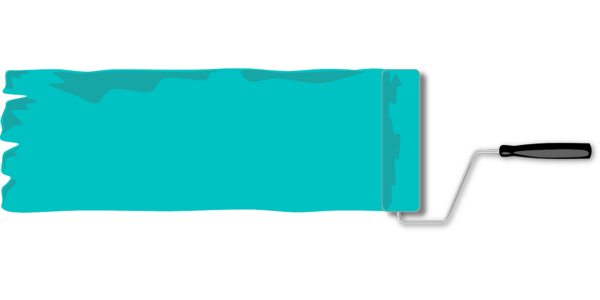Andreas Webers Roman „Lanz“ hat Franz Fend gelesen
„Haben Sie noch immer nicht begriffen, in welcher Gesellschaft Sie leben?“ fragt Raimund Jordan, eine der Hauptfiguren in Andreas Webers Roman „Lanz“, den Ich-Erzähler. Mit diesem kurzen Satz ist umrissen, worum es in Webers jüngst erschienenem Roman geht. Webers jüngstes Opus leistet nicht mehr und nicht weniger – in schlaglichtartigen Bildern der verschnarchten Kleinstadt Lanz – als die Verwobenheit und Affinität dieses Soziotops mit dem Faschismus darzustellen, die Täter- und die Mittäterschaft der honorigen Bürger, die zum aufgebrachten Mob werden, wenn die Volksgemeinschaft es verlangt.
Der Lynchmord der Lanzer Bürgerschaft an einer Halbjüdin in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges, die Recherchen des Ich-Erzählers über das Leben des Opfers der Volksgemeinschaft bilden den Rahmen dieses Sittenbildes einer österreichischen Kleinstadt, wie sie in jedem Bundesland sein könnte. Der Mord an einem Mädchen aus Lanz und die Tötung zweier vermeintlicher Zirkusaffen in den sechziger Jahren führen zunächst auf eine falsche Fährte. Sie haben nichts mit dem Mord an der Halbjüdin Anna Jordan zu tun. Sie erzeugen im Roman aber die erforderliche Aufgeregtheit, die das Klima von Gaunerei, Ehebruch, Feigheit und Denunziantentum so richtig zum Brodeln bringt, sodass sich ein biederer Bürger nach dem anderen entlarvt.
Dass der Faschismus nach dem militärischen Sieg in den Köpfen der Menschen besiegt werden müsse, forderte einst die große Schriftstellerin Anna Sehgers. Weber zeigt in seinem Roman, dass dies zumindest hierzulande nie gelungen ist, ja nie gewollt worden ist. Im Gegenteil, wenn Heinrich Dürrer, zur Zeit des Nationalsozialismus als SS-Mann in „einem Schloss in Oberösterreich“ und später in einem Lager im Osten im Einsatz, sagt: „Das alles hat mit mir nichts zu tun. Mich geht das gar nichts an. Ich sitze im Büro, kümmere mich um Proviant, Baumaterialien, Nachschub, ich schreibe Listen. Ich mache nicht mit. Ich tue nichts“, so ist das eine Haltung, die hierzulande immer sehr prominent vertreten worden ist, bis hin zu einem Bundespräsidenten.
Weber knüpft hier an Hanna Arendts Diktum von der Banalität des Bösen an. Die fürchterlichsten Verbrechen wurden begangen unter dem Deckmantel der Pflichterfüllung. Die Listen-Schreiber führten, wenn sie nicht gerade Listen schrieben, ein beschauliches Leben mit Haus, Frau, Kind und Hund. Und führten, als der „faschistische Spuk“ vorbei war, ihr Leben weiter mit Haus, Frau, Kind und Hund. Als Bürgermeister und Volksschuldirektor, als Gendarm, Winzer und Hobby-Maler, als Gemeindearzt. Doch wehe, wenn an der bürgerlichen Fassade gekratzt wird.
Weber schafft es, den ganzen Roman hindurch eine Spannung zu erzeugen, die sich nicht reißerisch hervortut, sondern stets auf kleiner Flamme am Köcheln gehalten wird. Das resultiert einerseits aus einer scheinbar gleichgültigen Haltung des Ich-Erzählers, der vorgeblich desinteressiert mehr und mehr Details aus den Biographien der Täter und der Opfer erfährt. Andererseits aus dem Auftauchen eines geheimnisvollen Fremden, der sich in weiterer Folge als Neffe des Mordopfers Anna Jordan herausstellt. Der scheint mehr über die Lanzer-Gesellschaft zu wissen, als dieser lieb ist. Seine Recherchen führen schließlich zu Prozessen gegen honorige Lanzer Bürger, die jedoch geendet haben wie so viele in der Zweiten Republik.
Andreas Weber belässt es nicht bei der Schilderung der Biographien von Tätern und Opfern. Er stellt in seinem Roman auch die Frage, ob Literatur die Ungeheuerlichkeit des Faschismus und des Holocaust zu erfassen und zu vermitteln vermag. „Alle Literatur ist völlig unnütz“, lässt er Raimund Jordan sagen. „Den Dichtern geht es darum, schöne Worte für schreckliche Dinge zu finden. Sie wollen den Gestank und das Unerträgliche beschreiben, in einer Sprache, an der gefeilt worden ist, auf dass die Lesenden mit der Beschreibung fremden Leids mehr als nur unterhalten werden.“ Weber hat diese Klippe umschifft, denn er hat nicht versucht, das Leid zu beschreiben, sondern die Gesellschaft, die an diesem Leid mitgewirkt hat. Der Roman von Andreas Weber ist ein wichtiges Buch. Jede wirklich wichtige Geschichte finde eines Tages jemanden, der sie aufschreibe, sagt Jordan zum Ich-Erzähler. Hier haben wir eine.
Nach dem Erzählband „Nachtspiel“, dem Essay über Hermann Gail „Der Speckjäger“, dem Theaterstück „Rebellen“ hat nun der Wahllinzer diesen Roman vorgelegt. Ein wirklich bemerkenswertes Buch, das nun auch in einem ordentlichen, seriösen Verlag erschienen ist.
Franz Fend lebt und arbeitet in Linz