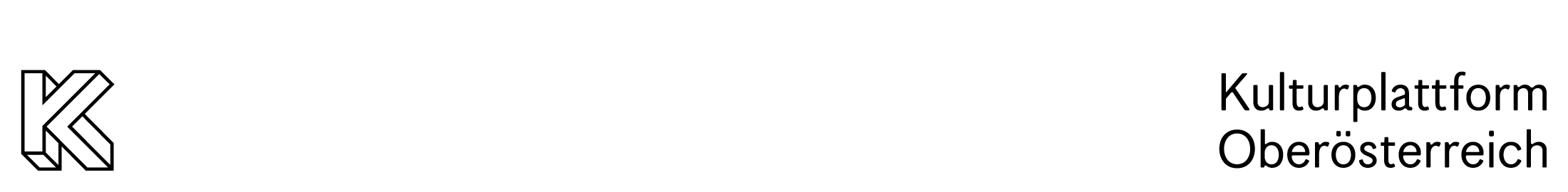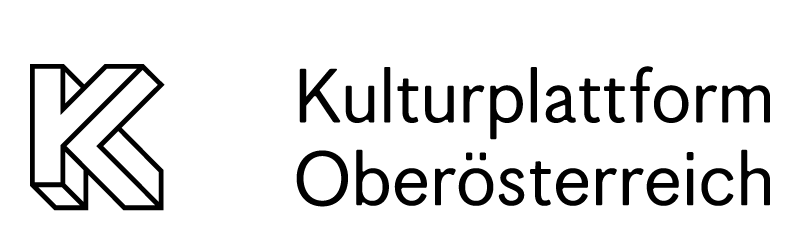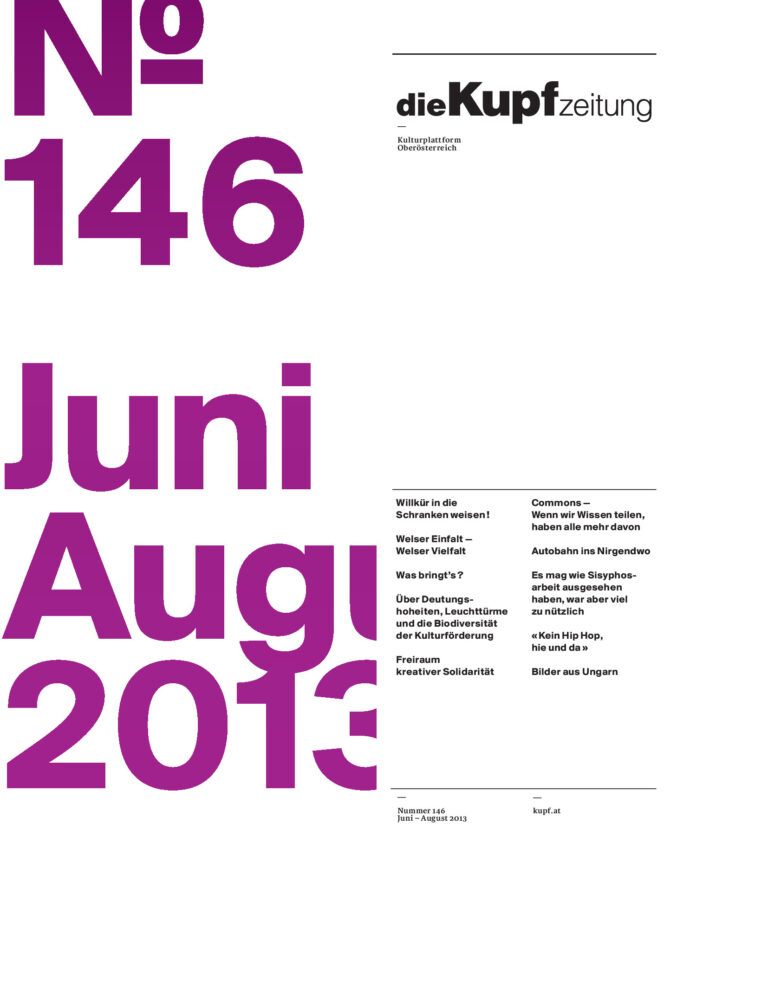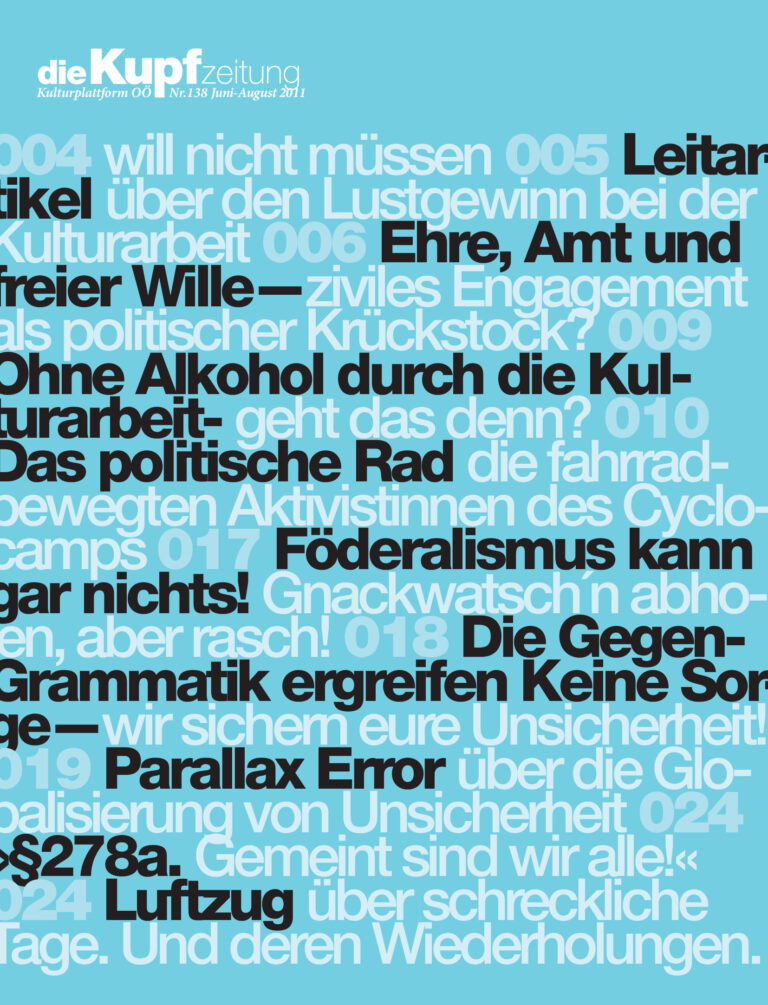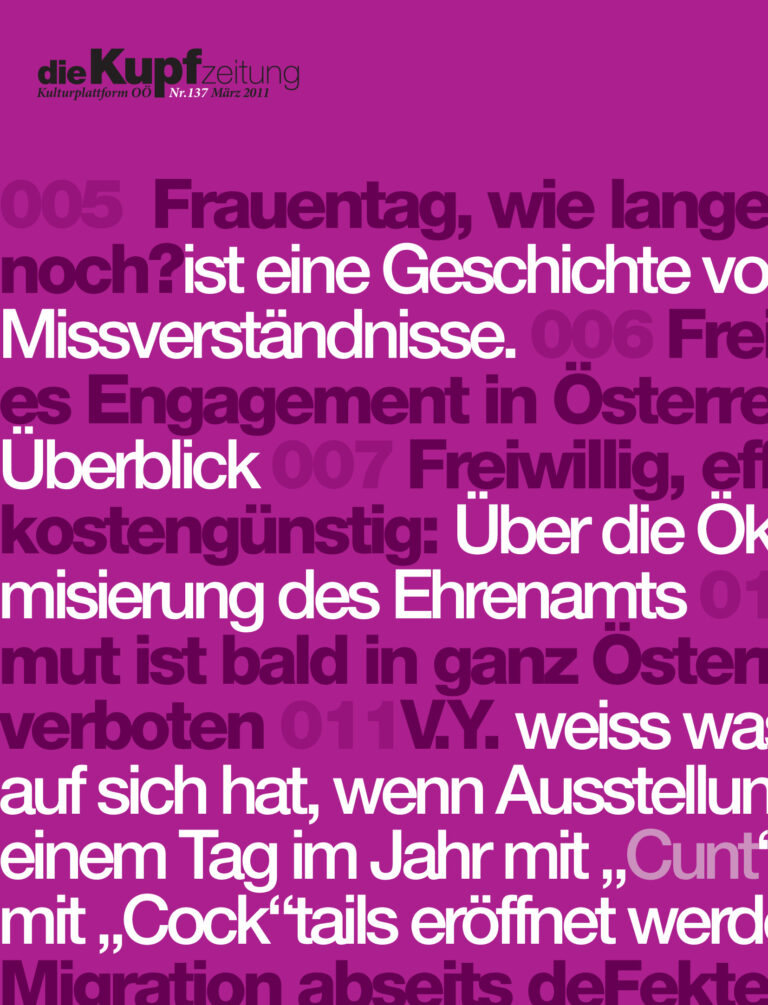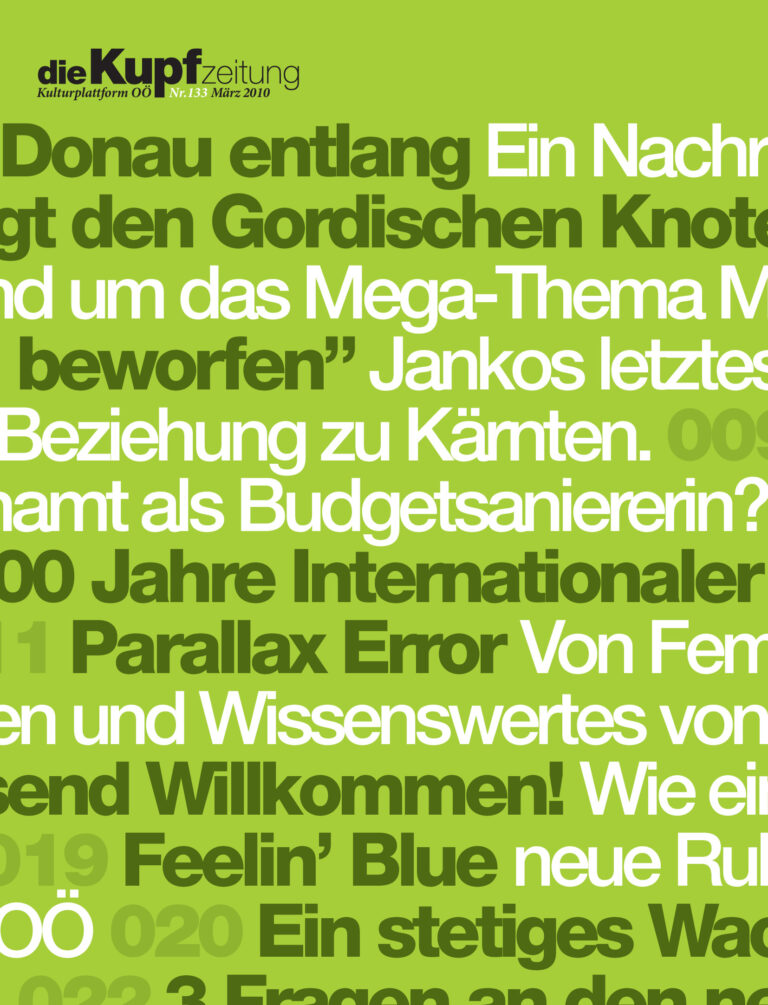Das Wörtchen „Queer“ war und ist ein bis heute umstrittener Begriff.
Viele verwenden „Queer“ anstelle des Überbegriffs LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual), andere hingegen wollen mit „Queer“ eben diese Identitätskategorien, die einer traditionellen Repräsentationspolitik und additiven Bewegungslogik folgen, kritisch hinterfragen. Auch für mich brachte „Queer“ lange Zeit genau das zum Ausdruck: Sexualität nicht isoliert von anderen gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen und Ordnungsbegriffen wie Race oder Klasse zu betrachten. Und somit eine gegen eine Single-Issues-Politik aufzutreten, wie sie schon von Feministinnen of Color in den 1980ern formulierte wurde, und die Grenzen separatistischer Organisationsformen zu sprengen (Bio-Frauen versus Transgender, Heteras versus Lesben usw.). Um es mit der afroamerikanischen feministischen Theoretikerin Cathy J. Cohen zu formulieren: „Für viele von uns symbolisiert das Label ‚queer‘ die Anerkennung, dass wir durch unsere Existenz und unser tagtägliches Überleben den fortwährenden und vielfältigen Widerstand gegen jene Systeme verkörpern (basierend auf den herrschenden Konstruktionen von Race und Gender), die danach trachten, unsere Sexualität zu normalisieren, unsere Arbeitskraft auszubeuten und unsere Sichtbarkeit einzuschränken.“
Nicht mehr eine homogene Gruppenidentität soll die Basis für kollektives Handeln bilden – vielmehr gilt es, Formen von Politik finden, die Identität nicht als Bedingung voraussetzen. Diese anti-essentialistische Kritik geht aber noch weiter: „Queer“ distanziert sich vom Geschwätz über „Minderheiten“ und vom Toleranz-Diskurs, weil diese die Bedingungen und Mechanismen, die die eigene Identität als „deviantes“ Subjekt hervorbringen, nicht berücksichtigen. Stattdessen wird der Blick verkehrt: Im Fokus steht nicht mehr die „Abweichung“, sondern die unsichtbare Norm, die die Ungleichheit (und damit die „Minderheit“) überhaupt erst hervorbringt. Entgegen seiner ursprünglichen Ausrichtung werden heute mit dem Begriff „Queer“ primär das sexuelle Begehren und die fließenden Grenzen sexueller Identitäten betont, während die Analyse sozialer/ökonomischer Prozesse immer wieder zu kurz kommt. Um „Queer“ im Sinne einer „widerständigen“ Identität zu re-formulieren, die über Sexualität hinausgeht, könnte ein Blick in die Archive lohnen – genauer in die radikalfeministischlesbischen Debatten seit den 1970ern. Das mag zunächst überraschen, galten doch Aktivistinnen aus jenem Kontext zu den schärfsten Kritikerinnen der Queer Theory. Doch eben hier wurde Lesbischsein nicht als vorrangig sexuelle, sondern als politische Identität begriffen, in der bewussten, ausschließlichen Bezugnahme auf andere Frauen innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft. Auch wenn inzwischen u.a. ein biologisch definiertes Verständnis von „Frau“ (zu Recht) angefochten wird: Queer sollte sich selbst nicht als Startpunkt für eine neue dissidente Politik verstehen, sondern vielmehr als deren konsequente, radikalisierte Weiterführung.
Vina Yun ist Redakteurin beim feministischen Monatsmagazin an.schläge sowie bei migrazine.at, dem Online-Magazin von Migrantinnen für alle.