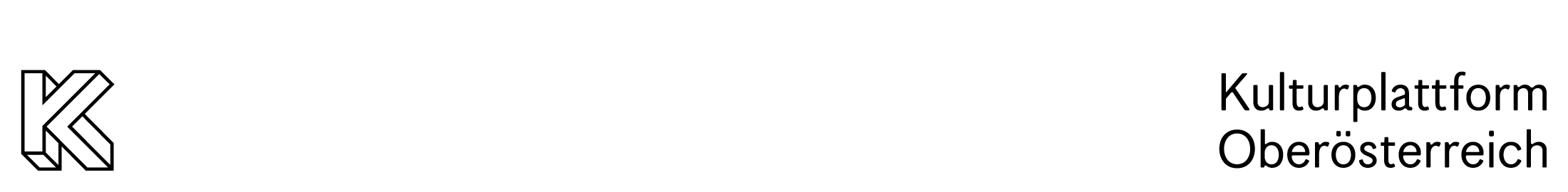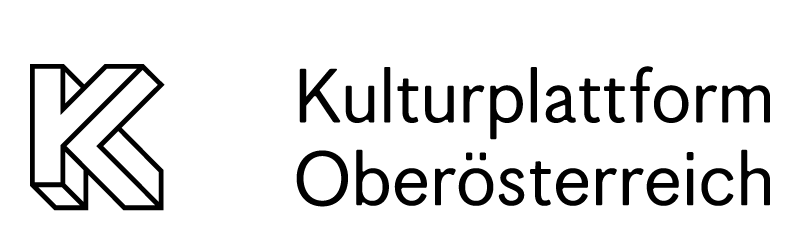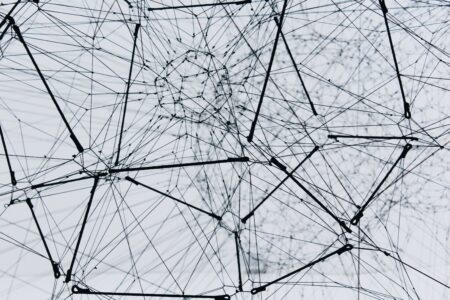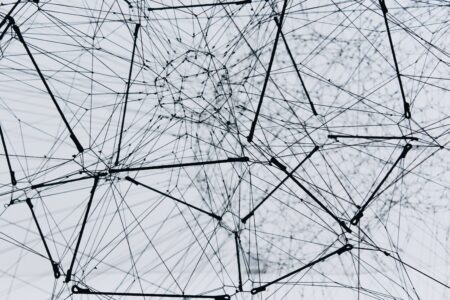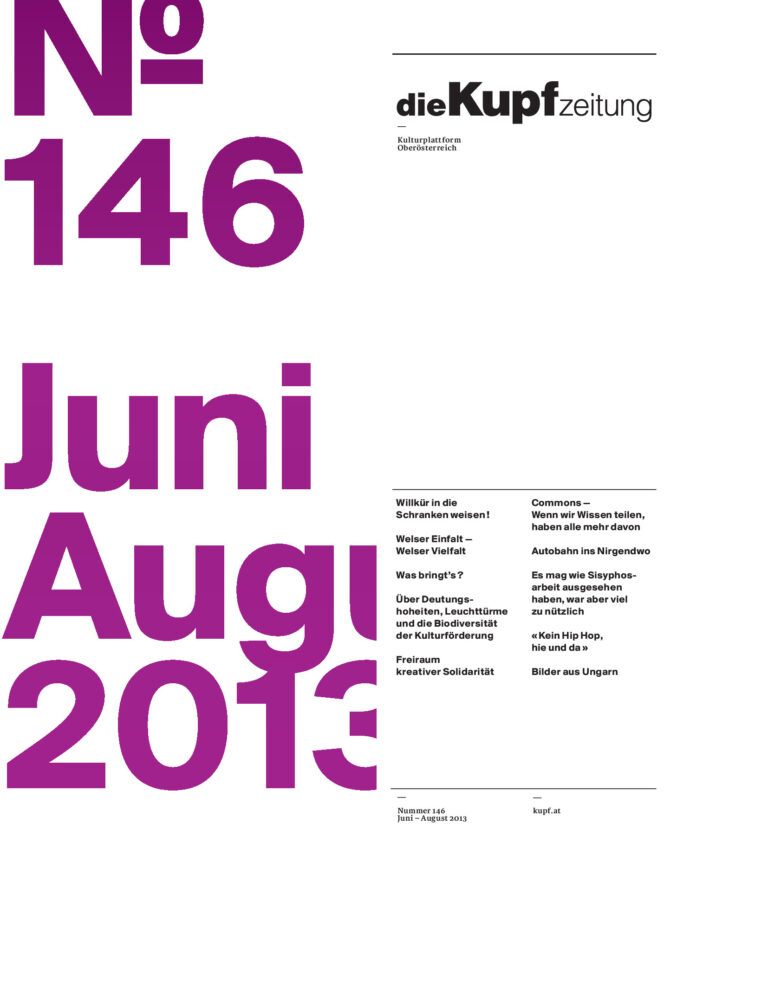I travel, because I have to.
I come back, because I love you.
Linz und ich haben uns an einem frühen Winterabend voneinander getrennt. Ob dies tatsächlich in beiderlei Einverständnis geschah, weiß ich bis heute nicht. Nur dass es eine Trennung auf Zeit sein sollte, war gewiss. Die Zeit sollte mir zeigen, wie ich mich in ihr fortbewege, wenn ich mich räumlich verschiebe und eine Stadt verlasse, die ich längstens meine Basis nannte. Über alles andere war ich mir nicht im Klaren. Wollte es auch nicht sein.
„Nein“ antwortete ich daher einsilbig auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum von Buenos Aires, entlang einer Beton- und Asphaltschneise, vorbei am Trainingsgelände der Nationalmannschaft, als mich der Taxifahrer mehrmals nach meiner Rolle in Argentinien fragte. Weder war ich als Student oder Businessman angereist, noch wollte ich Urlauber sein. (Wer will schon mehrere Monate Urlaub machen müssen?)
Ich war nicht auf der Flucht vor irgendetwas, keine Enttäuschung oder Müdigkeit trieb mich über den Atlantik ins Ausland. Auch kein Auftrag war vorhanden, mit dem ich entweder finanziell verdienen oder mich gar glorreich verdienen hätte können; etwa als Nazi-Jäger in Südamerika, wie ein On- und Offline- Freund kommentarfreudig und wahrscheinlich besoffen über meine Funktion „dort drüben“ mutmaßte.
In einer anderen Stadt noch einmal den Lieblingsbäcker und eine Stammkneipe finden zu müssen, so versuchte ich ein Bild davon zu geben, was einen dazu bewegen kann, in ein Land zu ziehen, wo man niemanden kennt und weder Sprache noch Kultur sein Eigen nennt. Dass ich „meine eigene Kultur“ als wenig ortsgebunden oder schwerfällig einschätzte, konnte ein gutes Vorzeichen für meine bevorstehende Assimilierung sein. Schließlich war ich es als
Musiker auf Tournee bereits gewohnt, mich binnen weniger Stunden mit den diversen örtlichen Gegebenheiten anzufreunden und während des Zelebrieres des kleinsten gemeinsamen Nenners (in meinem Falle: PunkRock) das Fremde an mich heranzulassen. Dass kulturelle und sprachliche Unkenntnisse eine Herausforderung für Zugezogene allerorts bedeuten, mir aber während meines Aufenthalts in Argentinien statt Rüffel meist wohlwollende Hilfestellungen seitens der Einheimischen und bisweilen sehr amüsante soziale Arrangements bescherten, musste mir vor dem Hintergrund der gegenwärtigen europäischen Praxis gegenüber Migrantinnen trotzdem ungewohnt vorkommen.
Es fiel mir leicht mich willkommen und von der Metropole umarmt zu fühlen. Ich ließ mich heftig an ihre und die Brust von 13 Millionen Menschen drücken. Mit ihnen teilte ich mir ab sofort die Straßen und die darauf oder darunter fahrenden Fortbewegungsmittel. Die Subte brachte mich unterirdisch zu Konzerten im bobofizierten Stadtteil Palermo, wo exemplarisch für das Leben an der Oberfläche Design mit Kunst verwechselt wird und die Lebensmittelpreise sich den Höhen der südamerikanischen Anden angleichen. Leistbare Taxis erleichterten oftmals die etwas beeinträchtigten Rückfahrten vom Fußballstadion oder vom Filmfestival in Abasto. Dessen Qualität zeigte sich in der Auswahl der Filme (eine Menge Überschneidungen mit Crossing Europe!) und ebenso darin, dass ein cinephiles Publikum fast alle Bevölkerungsschichten umfassen kann. Die kaum überschaubare Anzahl der fiependen und quietschenden Linienbusse brachte mich schließlich zu jeder Tages- und Nachtzeit überall hin; in die entlegensten Winkel der insgesamt 48 Stadtteile, die zu erreichen oft eine Ewigkeit, manchmal auch nur eine halbe brauchten.
Ob ich aus eigenem Antrieb ins kulturelle Leben von Buenos Aires eintauchte oder ob mich dieser Moloch unausweichlich in sich hineinzog, war an manchen Tagen schwer festzustellen. Es dauerte jedenfalls nicht lange, bis mich die Nächte verschluckten, ich mich an aufregenden Orten in lebhafte Gespräche verwickelt sah, mit Künstlerinnen, Musik-Nerds, Kellnerinnen und darüber hinaus auch mit normalen Menschen Bekanntschaft schloss. Abende im La Catedral zählten dabei zum Besten. In einem Tanzsaal im ersten Stock einer ehemaligen Lagerhalle konnte man bei einer Atmosphäre, die mich an die besten und schrulligsten Squats Europas erinnerte, den anmutigen Bewegungen Tango tanzender Paare folgen. Undenkbar war es für mich bis dahin, Tangomusik größere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Interesse daran wuchs (ebenso wie meine Neugierde an lateinamerikanischer Musik im Allgemeinen) parallel zur Einsicht, dass spannende Auswüchse von Rockmusik und digital erzeugter Musik in Buenos Aires kaum zu finden sind. Der Punk spielte sich quasi woanders ab. Sollte mir recht sein. So fand mein Sinn für schablonenarme Musik immer öfter Zuflucht in der Improvisationsszene. Bespielt wurden Galerien, Bars und illegale Kellerlöcher. Es galt das Berlin-Prinzip: Spielen kannst du fünf Mal die Woche, Geld bekommst du keines.
Ausgespuckt vom Nachtleben, dem gierigen Schlund dieser Stadt, konnte ich bei Tageslicht auf meinem Zimmer arbeiten. Und zwar an einem Film. Eine Dokumentation über das Alltagsleben im Salzkammergut der 1960er und -70er sollte es werden. Dass ich mich ausgerechnet in Argentinien zu einer Arbeit übers Salzkammergut setzte, brachte mich des Öfteren zum Lachen, niemals in Verlegenheit. Während draußen vor dem Fenster die Cartoneros den Müll durchsuchten, um den gesammelten Karton später bei einer Sammelstelle abzuliefern, durchwühlte ich altes Super-8 Material nach brauchbaren Sequenzen. Mülltrennung in der Parallel-Montage. Auf meiner Sammelstelle – einem improvisierten Schnittplatz – türmten sich brutale Geschichten aus einer vergangenen Zeit; gesellschaftlicher Dreck, der unter den Teppich der Verdrängung gekehrt wurde. Das stank bis Argentinien. Es stank aber auch ein wenig nach Argentinien. Auch hier ist man noch dabei, soziale und politische Abgründe – vor allem aus der jüngeren Vergangenheit und der Zeit der Diktatur – aufarbeiten zu müssen. Pino Solanas erzählt davon eindringlich in Filmen wie Memoria del Saqueo – Chronik einer Plünderung oder La dignidad des los nadies (Die Würde der Niemande).
Das Land ist (wie viele lateinamerikanische Länder) noch immer gespalten in seinen sozialen Strukturen; die Rechte der indigenen Völker werden mit Füßen getreten, der Reichtum der Wenigen wirkt im Verhältnis zur mehrheitlich armen Bevölkerung zynisch; und die in Argentinien lange Zeit existente Mittelschicht wurde spätestens mit dem Staatskonkurs vor 10 Jahren ausgelöscht. Das traditionsreiche Bürgertum in der Stadt Buenos Aires spiegelt sich zwar nach wie vor in den Wohnverhältnissen oder im Ausstellungs- und Museenangebot wieder, dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass diese Angebote zu einem ungesunden Prozentsatz nur von den Touristen und den ausländischen Studierenden angenommen werden können. Letztere sind in BAires (so nennen die US-amerikanischen Gäste die Hauptstadt) zahlreich vorhanden. Sie besuchen in den seltensten Fällen die öffentlichen Universitäten, sondern bleiben in den Satellitenablegern ihrer heimischen Elite-Unis lieber unter sich.
Keinen Sonderstatus haben Krisen in Argentinien. Eine Krise, sei sie ökonomischer oder politischer Natur, gilt vielen nur als eine weitere Episode im Kontinuum einer permanenten Krise. Davon zeugten die fast alltäglichen Demonstrationen in der Stadt, von denen ich das eine und andere Mal ein wenig überrascht wurde, wenn sie plötzlich meine Wege kreuzten oder den Straßenverkehr auf der Avenida 9 de Julio, der angeblich breitesten Straße der Welt, lahmlegten. Für die persönlichen Krisen sind in Buenos Aires so viele Psychiater zur Stelle wie in keiner anderen Stadt der Welt. Mentale Schützenhilfe musste ich aber während der Monate in Buenos Aires, in der Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Arbeit kaum anfordern. Meine bis zuletzt ausgedehnten Erkundungsspaziergänge hinterließen zwar nur verschwommene Bilder in meinem Kopf, jedoch zeichnete sich im Laufe der Zeit ab, dass die unscharfen Konturen meiner Beweggründe letztlich doch ein klares Bild von meinem Aufenthalt und meiner Rolle in Argentinien preisgaben. Es gab also keinen Grund traurig zu sein. Zu lebensfroh stattete mich die Umgebung täglich aus. Zu sicher war ich mir auch in jenen Momenten, in denen ich Freunde, die Lieben und Liebste vermisste, dass Linz ja doch nur um die nächste Wolkenecke liegt und dass die Beziehung zu meiner Heimatstadt jederzeit wieder problemlos aufgenommen werden könnte. Ich sollte mich getäuscht haben. Claro.