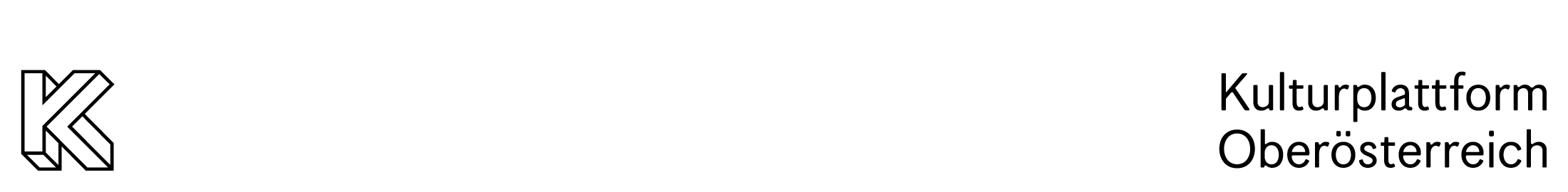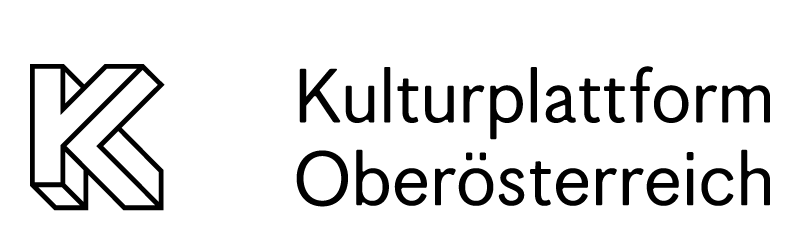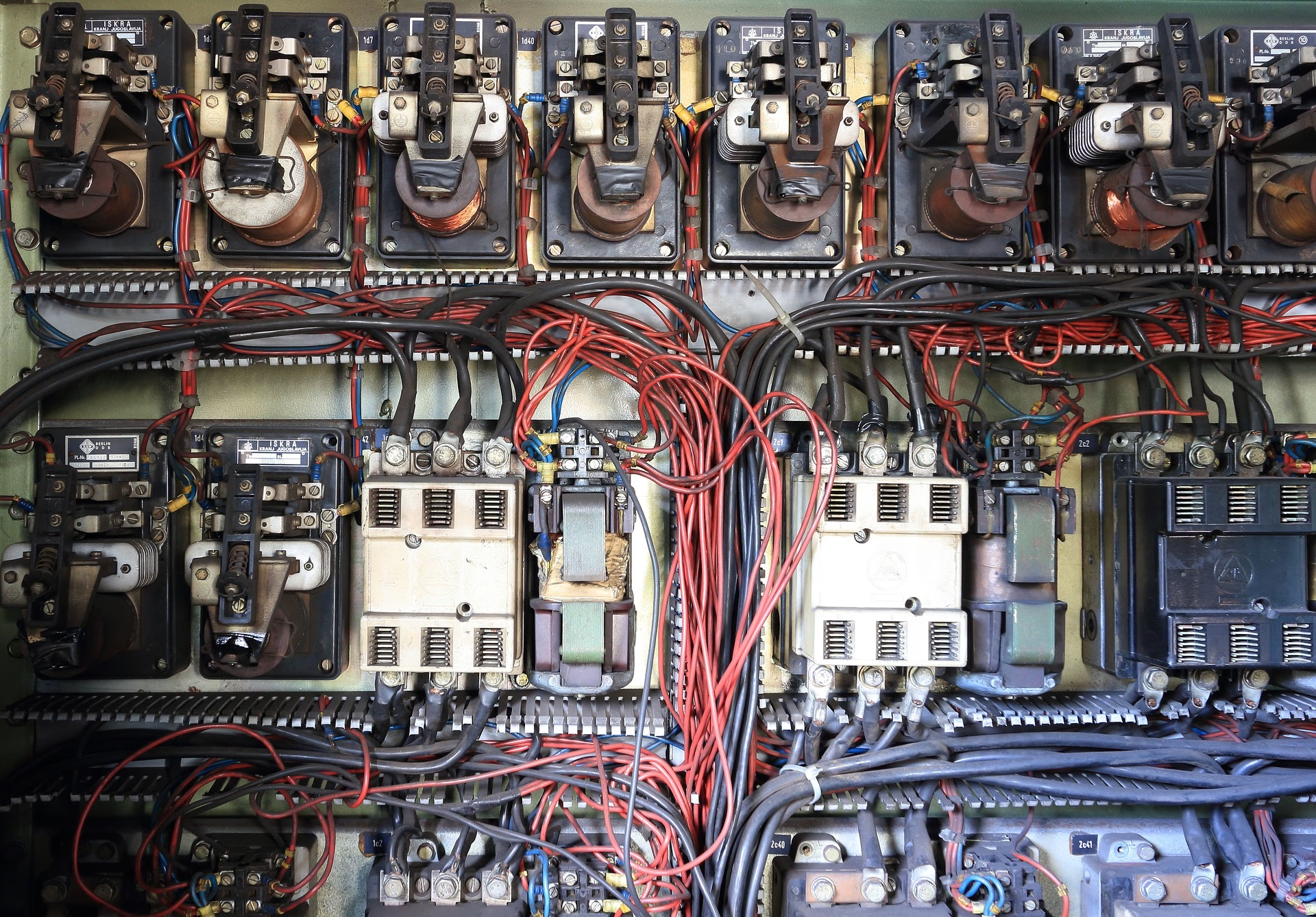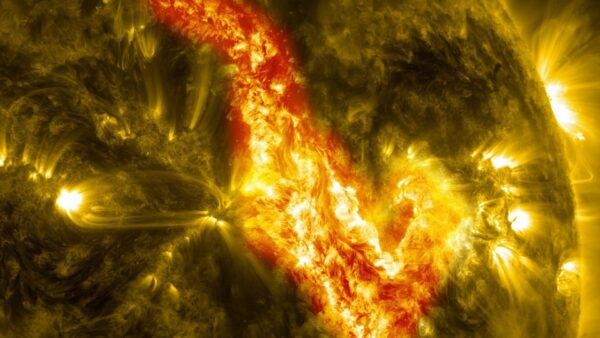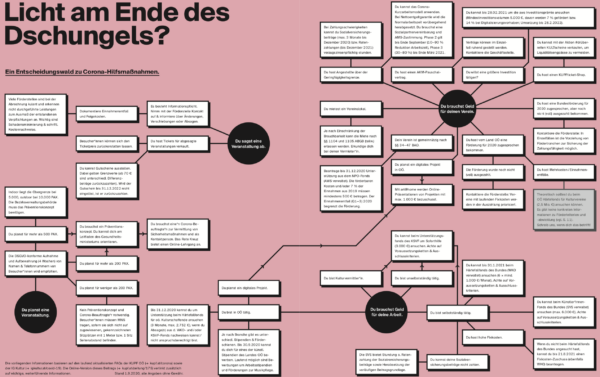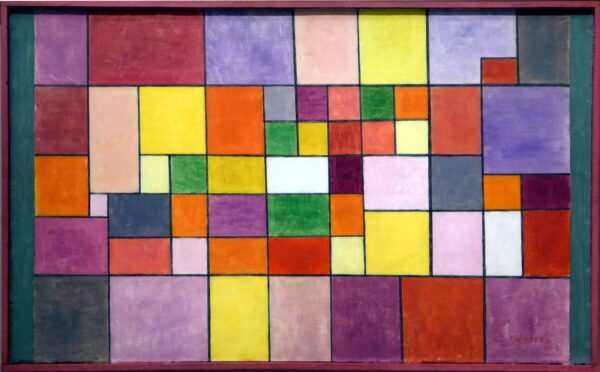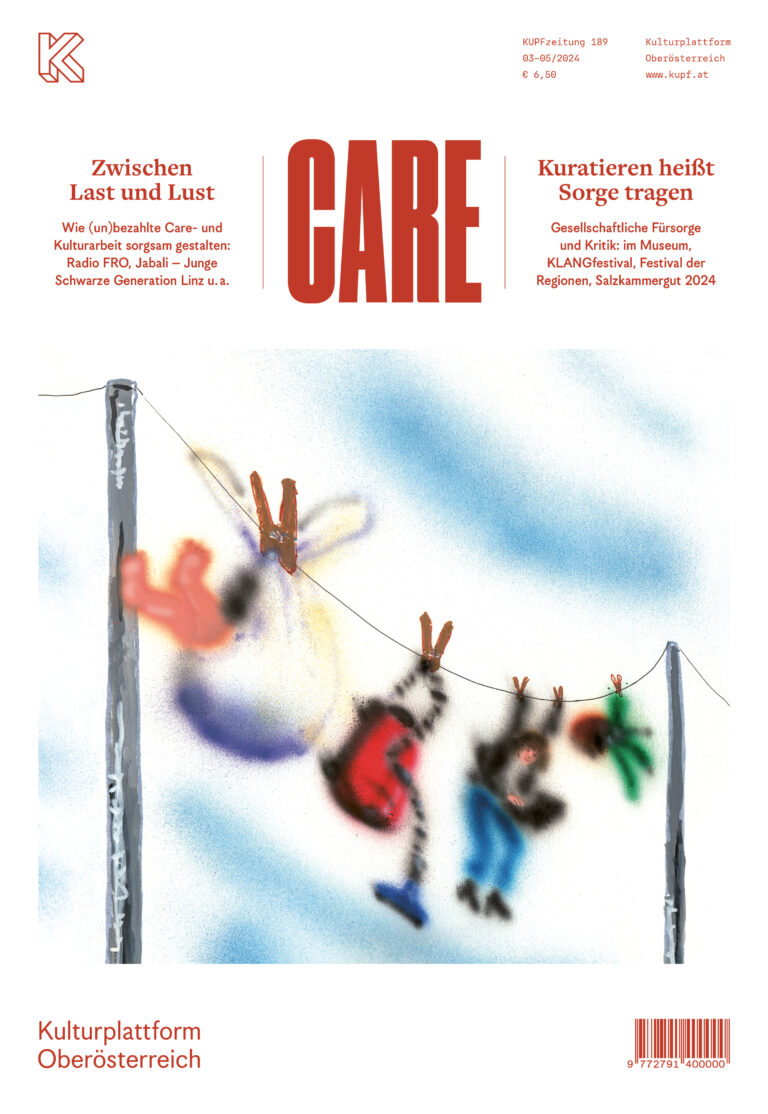Im Gespräch mit Aliette Dörflinger ergründen wir das Verhältnis zwischen Kunst, Kultur und Verwaltung und wie Förderinstrumente in dem Bereich funktionieren … – oder funktionieren sollten.
Katharina Serles: In deinem Modul des KUPF OÖ-Lehrgangs für Kunst- und Kulturmanagement hast du über das chaordische Prinzip gesprochen. Was ist das?
Aliette Dörflinger: In unserem Leben gibt es unterschiedliche Zustände: vom Zustand des Chaos, aus dem wir alle entstanden sind, zum Zustand der Ordnung und Kontrolle. Letztere haben wir hineingebracht, um als Gesellschaft zusammenzuleben und Dinge gestalten zu können. Mit Hilfe des chaordischen Prinzips wird das Spannungsfeld zwischen diesen Zuständen genutzt – mit der Motivation, zu Innovation oder Humus für Neues zu gelangen. Das kann auf Organisations-Ebene sein, weil alte Systeme nicht mehr funktionieren oder man die Organisation weiterentwickeln möchte oder man für einen Prozess neue Ideen braucht.
Wie geht man dabei vor?
Charakteristisch für Vereine und NPO-Konstruktionen aus dem Bereich Kunst und Kultur sowie kreativwirtschaftliche Unternehmen ist, dass diese das Prinzip oft wie selbstverständlich anwenden. Dort ist Struktur verhanden, aber sie nimmt nicht die Überhand, um dem ‹Zufall› einen Möglichkeitsraum zu geben. Wenn es ein Sofa im Büro gibt und man beim Nachmittagsschlaf auf gute Ideen kommen kann, eine Gemeinschaftsküche für einen leichten Austausch und Orte für Inspiration, dann ist das Chaordische leicht zu erreichen.
Und was passiert dann?
Die Strukturen, die man kennt, die historisch gewachsen sind oder von oben gegeben, können geändert werden, indem man ins Chaos hineingeht, organischere Energie hinein- und mehr Kreativität, Spontaneität und Intuition zulässt. Ob die Ideen, die dabei entstehen, tatsächlich umgesetzt werden, ist dann eine ganz andere Frage. So ein Prozess muss gehostet werden, damit sich alle Beteiligten gut einbringen und alle Ergebnisse gut geerntet werden können.
Diese angesprochenen Freiräume sind corona-bedingt prekärer geworden, weil Kontakt, Nähe, Austausch problematisch, potentiell gefährlich sind. Wirkt sich das auf kreative Prozesse aus?
Ich denke, dass Menschen soziale Wesen sind, die immer Begegnungsräume finden, selbst wenn sie zeitweise bloß virtuell sind. Ich vertraue also darauf, dass wir trotz einer Pandemie Wege und Räume für Austausch finden. Auch das Home-Office kann temporär Neues schaffen und andere Freiräume bringen.
Wie passt denn nun das oftmals chaordische Arbeiten von Kulturinitiativen zum starren, kontrollierenden Verwaltungsapparat? Muss sich das nicht jedenfalls irgendwo spießen?
Der Knackpunkt ist, dass es in Kulturförderungskontexten um öffentliche Steuergelder geht. Der Staat ist in der Verantwortung, transparent aufzuzeigen, was mit diesen Geldern passiert. Es passiert eigentlich eine Umverteilung. Die Politik entscheidet im Sinne einer Kulturstrategie, wie Geld vergeben und etwa zwischen den großen Institutionen und der Freien Szene aufgeteilt wird. Die Verwaltung muss es dann verteilen, woraus sich bei gutem Public Management Qualitätskriterien und Richtlinien ergeben, die für alle klar kommuniziert, fair konzipiert und transparent nachvollziehbar sind.
Entspricht das den Förderwirklichkeiten?
Leider nicht immer. Je nach Förderorganisation oder Ebene der Fördervergabe (von der kommunalen zur Bundesebene) ist die Transparenz der Kriterien oder des Vergabeprozesses mehr oder weniger gegeben. Manche Personen haben einen Informationsvorsprung – der Zugang zu Fördertöpfen wird dadurch erleichtert. Auch das im Kunst- und Kulturbereich gängige Beiräte-System ist oft eher undurchdringlich.
Gibt es Beispiele für Förderinstrumente, bei denen das besser funktioniert?
Der österreichische Staat hat zum Beispiel Förderagenturen geschaffen – im Bereich der Wissenschafts-, Wirtschafts- und Innovationsförderung –, die unabhängig von den Ministerien und so weit wie möglich vom politischen Spiel entkoppelt sind. Das sichert ein gutes Entscheidungsverfahren – und das fehlt teilweise im Bereich der Kunst und Kultur.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass das Antragsprozedere oft so schleppend und behäbig ist?
Für die Vergabe braucht es immer auch eine gewisse Vergleichbarkeit der Anträge. Dafür sind etwa Formulare hilfreich. Das ist auch der Grund für sehr spezifische, zum Teil einengende Vorgaben – und gar nicht negativ. Natürlich kann man als Fördergeber*in andererseits auch auf die Freiheit von Wissenschaft, Innovation, Kunst bauen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass man Wissenschaftler*innen, Künstler*innen oder Kulturarbeiter*innen nicht eingrenzt, denn dann denken und arbeiten sie besser. Es hängt letztlich von der Zielvorgabe ab: Je nach Förderungsziel ist ein formloser Antrag oder ein Antrag mit klaren Vorgaben besser. Entscheidend ist die Verhältnismäßigkeit: Braucht es so viele Angaben? Wie fließen diese in die Entscheidung ein? Hier sind die Fördergeber*innen gefordert, zu überprüfen, ob wirklich notwendige Daten und Informationen abgefragt werden, die nicht bloß zur eigenen Absicherung dienen.
Bei Antragstellungen, wie wir sie im Kunst- und Kulturbereich kennen, muss vor Projektbeginn feststehen, worauf man hinaus will. Selten ist es möglich zu sagen: Gebt mir eine Förderung für die Couch, für den Freiraum, und wir schauen, wohin wir damit kommen. Wie könnte man das denn gewährleisten?
Leider herrscht oft der Glaube: Je strenger die Vorgaben, je größer die Kontrolle, je enger der Gestaltungsraum, umso sicherer wird das Ziel erreicht. Aber es gibt andere Ansätze, zum Beispiel in der Förderung der Grundlagenforschung: Bewertet werden wissenschaftliche Qualifikation, Idee und Methodenset. Das Ergebnis ist offen, nicht plan- und trotzdem im Nachhinein evaluierbar. Die Rahmenbedingungen sind breit, (Denk-)Räume werden aufgemacht. Dieses Prinzip stärker in die Kunst- und Kulturförderung hineinzubringen, wäre schön. Dann müsste sie nicht nur aus Projektförderungen bestehen und diesen Wirkungs- bzw. Umsetzungscharakter haben; das ist aber eine strategische, politische Entscheidung. Arbeitsstipendien, Förderinstrumente mit stärkerem Prozesscharakter gehen bereits in diese Richtung.
Der Eindruck bleibt, dass die Politik einen strengeren Blick auf Kunst und Kultur wirft, als etwa auf die Wissenschaft. Ist Kunst zu gefährlich?
Kunst ist zu unkontrollierbar und vor allem nicht produktiv im neoliberalen Sinn. Der Mehrwert von Kunst und Kultur wird in diesem System nicht ausreichend wahrgenommen. Sobald die Ressourcen knapp werden – auf systemischer Ebene geht es ohnehin immer um den Kampf um Ressourcen – hat Kulturpolitik daher einen schweren Stand. Und das wenige Geld, das sie verteilen kann, muss in dieser Logik ‹etwas bringen› – deswegen gibt es Projekt- statt Prozessförderungen.
Lust auf mehr?
Aliette Dörflinger im KUPFtalk mit Sigrid Ecker und Florian Walter ist in der KUPF Radio Show nachzuhören.
Aliette Dörflinger ist studierte Handelswissenschaftlerin und ausgebildete Trainerin / Coach (u. a. Art of Hosting Practitioner). Sie hat über zehn Jahre in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, neue Formen von Unternehmertum, regionale Entwicklung sowie Innovation und Entrepreneurship geforscht. Sie war als Evaluatorin von Innovationsprogrammen für KMUs tätig und hat für den FWF Wissenschaftsfonds ein neues Förderprogramm für transdisziplinäre Forschung implementiert. Aktuell ist sie als selbstständige Prozessbegleiterin, Beraterin und Trainerin, u. a. für partizipative Stakeholderund Veränderungsprozesse, sowie in der Erwachsenenbildung tätig.