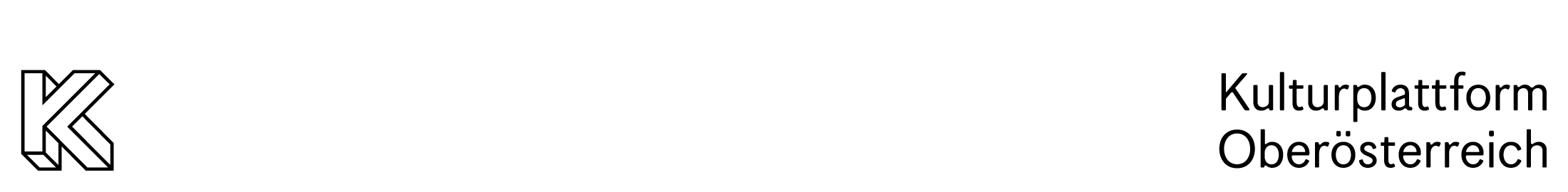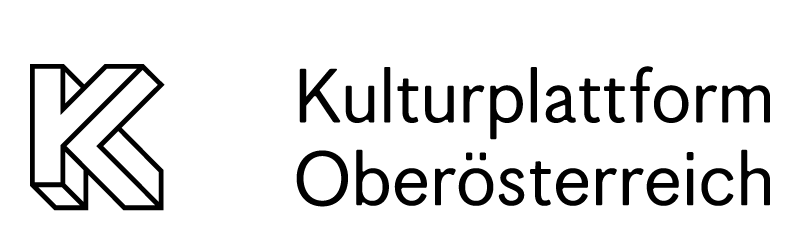Die Linz Club Commission lud in Kooperation mit der KUPF OÖ am 12. Februar zum Webinar Inclusion Day 2025 – Gemeinsam Safe(r) Spaces schaffen ein, um über auf Ableismus im Veranstaltungskontext zu sprechen und zu diskutieren, welche barrierearmen Maßnahmen es gibt und wie wir unseren Veranstaltungsalltag inklusiver gestalten können. 26 Teilnehmer*innen waren mit dabei.
Die beiden Vortragenden Michaela Joch und Martina Gollner ließen uns an ihrer umfassenden Expertise zum Thema teilhaben.
Michaela Joch ist freiberufliche Trainierin und bietet Workshops zu Inklusion am Arbeitsplatz & im Studium an. Sie ist Gründungsmitglied des Kompetenzteams Frauen mit Behinderungen (Österreichischer Behindertenrat) und engagiert sich in der Interessensvertretung im Verein FmB – Frauen* mit Behinderungen.
Martina Gollner ist Mitgründerin der FullAccess Event Services OG, die sich als Accessibility Consulting Agentur fokussiert. Sie hat langjährige Erfahrung als Sozialarbeiterin im Handlungsfeld „Behinderung“ sowie als Mitglied des Kompetenzteams „Frauen mit Behinderung“ des Österreichischen Behindertenrates.
Die beiden starteten mit Informationen zum Thema Menschen mit Behinderungen. In Österreich leben 25% aller Menschen zwischen 15 und 89 Jahren mit einer Behinderung. Laut UN-Behindertenrechtskonvention: „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“
Über 57% aller Menschen mit Behinderungen fühlen sich in der Freizeit aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt (lt. Behindertenbericht 2016)
Was ist Ableismus? Der Begriff leitet sich vom englischen ableism ab, was mit Fähigkeitsnorm übersetzt werden kann. Ähnlich wie Sexismus oder Rassismus bietet Ableismus einen hilfreichen Rahmen für die theoretische, parktische und aktivistische Aufarbeitung von Diskriminierungserfahrungen. Das heißt, dass Nicht-Beginderung als Norm gesehen wird. Normen sollten aber von allen erfüllt werden können, was in diesem Fall nicht zutreffen kann.
Im Workshop wurde unter anderem diskutiert, dass (teilwiese unsichtbare) soziale Normen und Rollenerwartungen jede Gesellschaft prägen. Wichtig ist, es für barrierearme Gestaltung von gemeinsam genutzten physischen, virtuellen und sozialen Räumen zu sorgen, um die Zugänglichkeit zu erleichtern.
Traurige Realität ist, dass behinderungsspezifische Gewalterfahrungen im Alltag sehr häuftig vorkommen. Dies äußert sich einerseits durch eine ständige implizite und explizite Konfrontation damit, dass ein Leben mit Behinderungen gesellschaftlich als „schlechter“ gesehen wird, aber auch durch Mobbing, Ausgrenzung, Demütigung, körperliche Gewalt, Wegnehmen oder Beschädigen von Hilfsmitteln, Vernachlässigung, absichtliches Triggern von Symptomen, Ausnutzen von Abhängigkeiten, und „Zwang zu Funktionieren“. Auch sexualisierte Gewalt vor allem gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen kommt häufig vor.
Gewaltschutzkonzepte, die gemeinsam mit Expert*innen für Behinderungen entwickelt werden sollen, sind aus diesem Grund für Veranstalter*innen wichtig. Bei der Erstellung dieser ist es wichtig zu verstehen, dass die gesammelten Lebenserfahrungen von Frauen mit Behinderungen die Reaktion auf Gewalterfahrungen beeinflussen: Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mir Hilfe hole? Wie reagiere ich auf Hilfsangebote?
Im zweiten Teil des Workshops wurde diskutiert, wie Barrierearmut in die Praxis des Nachtlebens integriert werden kann? Was ist dabei wichtig?
Auf Gesetzesseite sind dabei die länderspezifischen Veranstaltungsgesetze / Veranstaltungssicherheits-gesetzte zu beachten, auf Normenseite die ÖNORM B 1600 und ÖNORM B1603.
Barrierearmut ist im Veranstaltungsbereich das aktuelle beste Wording, es bietet eine realistische Einschätzung des Status quo und hilft Fortschritte im Prozesse zu kommunizeren.
Folgende Punkte sind im ersten Schritt wichtig:
– Realistische Informationen zu Barrieren / Barrierearmut der Veranstaltungsstätte auf der Webseite bereitstellen
– Informationen zur Anreise bereitstellen, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch in Bezug zu behindertengerechten Parkplätzen
– Beschilderung der Veranstaltung in gut sichtbaren kontrastreichen Farben in angemessener Höhe publizieren (Aufsteller sind oft die beste Wahl)
– Veranstaltungsräume und Podium / Bühne muss schwellenfrei betretbar sein, Stufen sollen gut sichtbar gekennzeichnet werden
– In der Gastronomie empfielt es sich, nicht nur handschriftliche Tafeln mit Angebot über der Bar zu nutzen, sondern z.B. auch in kontrastreichen Farben gedruckte Karten bereit zu halten
– Saubere, barrierefreie Toiletten, die nicht gleichzeitig als Abstellraum genutzt werden, sind ebenfalls sehr wichtig für alle Beteiligten
– Unterstützung anbieten, kommunizieren und aktiv nach Anforderungen fragen
– Begleitpersonenkarten anbieten
Alle Maßnahmen gelten nicht nur für Besucher*innen, sondern auch für Künstler*innen und Mitarbeitende.
Im Workshop wurde ausführlich diskutiert und es wurden viele Erfahrungen geteilt.
Moderiert wurde der Abend von der KUPF OÖ.
Zum Nachhören:
Michaela Joch und Martina Gollner waren auch bei Radio Fro zum Interview: Hört den Beitrag Fortgehen im Behinderung nach.
Links:
Barrierecheck von WKÖ und ÖZIV – Bundesverband für Menschen mit Behinderungen
Ableismus erkennen
Achtsam über Behinderungen sprechen
Gewaltschutz für Frauen mit Behinderungen:
Broschüren von Ninlil/Kraftwerk
Access to Specialised Victim Support Services for Disabled and Deaf Women who Experience Violence’
Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen