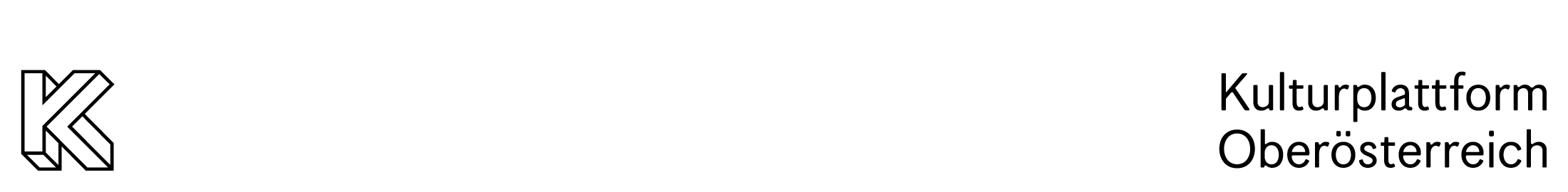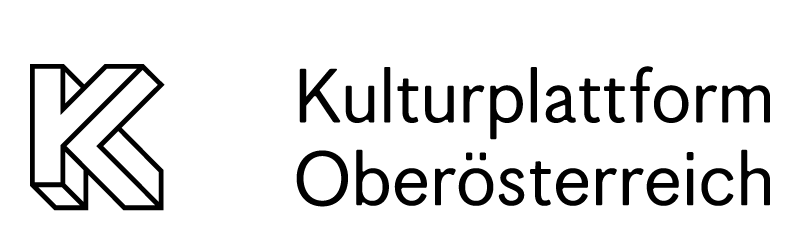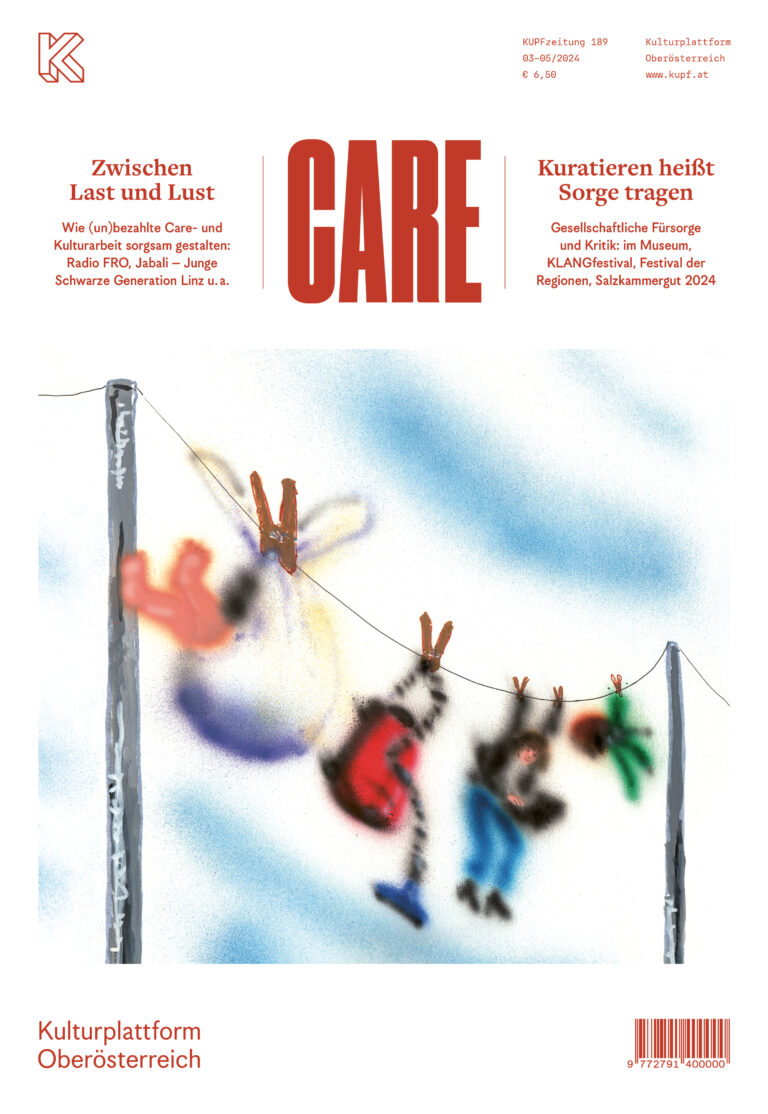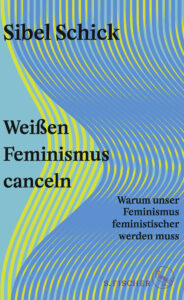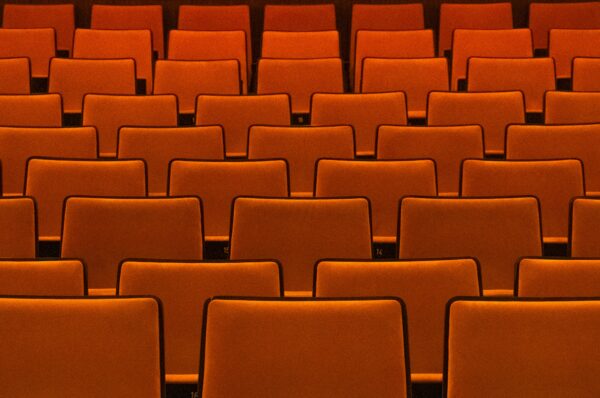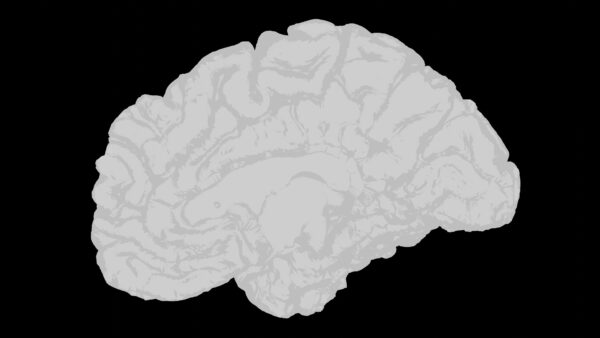Über Prekarität und psychische Erkrankungen im Kunst- und Kulturbereich und wie wir die Bedingungen für sämtliche Lohnarbeiten besser gestalten können. Von Michaela Maria Hintermayr.
Prekarität im Kulturbetrieb bedeutet, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen von Kreativen häufig unsicher, instabil und ungeschützt sind. Diese hat sich zuletzt durch die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen weiter verstärkt. Künstler*innen sind oft von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, niedrigem Einkommen, fehlender sozialer Absicherung und hohem Druck betroffen. Prekarität gefährdet aber nicht nur die materielle Existenz, sondern auch die gesellschaftliche Teilhabe. Das hängt damit zusammen, dass Prekarität isoliert und spaltet. Zudem werden die Betroffenen häufig in Konkurrenzverhältnisse zueinander gesetzt. Dies erschwert eine solidarische Praxis und kollektive Organisierung. Dahingehend kann ohne ein privates und jederzeit verfügbares ökonomisches und soziales Sicherheitsnetz eine psychische Krise schnell existenzbedrohend werden. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Kosten für die Behandlung einer psychischen Erkrankung zu großen Teilen noch immer privat zu stemmen sind. Darüber hinaus werden Stress, Angst und Burnout häufig tabuisiert, schulterzuckend als Preis der Selbstverwirklichung postuliert oder gar positiv umgewertet.
Das leidende, aber produktive Genie?
Es herrscht eine rege Debatte, ob psychische Erkrankungen der Motor für Kreativität und künstlerischen Output sind. Dahingehend trifft man regelmäßig auf die Figur des seelisch leidenden Genies. Diese gilt es zu problematisieren. Handelt es sich dabei doch meist um einen weißen, männlich gelesenen Künstler, der „geniale“ Werke trotz, oder vielmehr unter Ausnutzung eines Leidens erschafft. Vincent van Gogh und Ernest Hemingway können als Prototypen dieser Figur gelten.
Mit der mythischen Überhöhung und Romantisierung der Seelenleiden von Künstler*innen geht eine Entpolitisierung von psychischen Erkrankungen und deren sozialer Dimension einher. Erfolgt doch das Produktivmachen von mentalem Leiden um den Preis, dass die damit verbundene Verletzlichkeit und Abhängigkeit ausgeblendet wird. Das heißt, dass der soziale und der monetäre Aspekt, die notwendig sind, um eine Krise zu überwinden, verschleiert werden. Gleichzeitig wird psychische Not als eine fruchtbare Basis für Produktivität eingeordnet und damit bagatellisiert.
Neben dieser Bewegung, die es verbietet, Kunst in die Niederungen des Ökonomischen zu führen, gibt es noch eine weitere, nur scheinbar gegenläufige. Wie von Eliah Lüthi ausgeführt, ist künstlerisches Schaffen, das explizit in psychiatrischen Kontexten entstand, gefährdet, beschnitten und zu einem eigenen Genre umetikettiert zu werden. Die Stichwörter Anstaltskunst oder Outsider-Ouevre lassen grüßen. Daher überrascht es nicht, dass sich etwa Christine Lavant dagegen verwehrt hat, dass ihre Aufzeichnungen aus dem „Irrenhaus“ zu Lebzeiten veröffentlicht werden. Geht es doch hier auch darum, Arbeit nicht als solche anzuerkennen.
Maßnahmen und Arbeitsbedingungen
Obwohl Prekarität im Kunstbetrieb stets als ein individuelles Problem sowie als ein persönliches und selbstgewähltes Risiko gerahmt wird, verbirgt sich dahinter ein strukturelles und politisches Problem. Um Prekarität im Kunstbetrieb zu bekämpfen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven Ebene ansetzen. Dazu gehören unter anderem die Verbesserung der sozialen und rechtlichen Absicherung, die Erhöhung der öffentlichen und privaten Finanzierung, die Schaffung von fairen und transparenten Arbeitsbedingungen, die Stärkung der künstlerischen Bildung und Vermittlung, die Förderung der kulturellen Vielfalt und Teilhabe, die Vernetzung und Kooperation der Künstler*innen und die Entwicklung einer kritischen und emanzipatorischen Kunstpraxis.
Wie wir arbeiten wollen
Letztendlich geht es aber auch darum, wie wir über Arbeit und insbesondere gedeihliche Arbeitsbedingungen denken. Wollen wir wirklich, dass eine kreative Tätigkeit gleichbedeutend ist mit Stress, Burnout und großem persönlichen Risiko? Sollten wir hingegen nicht vielmehr danach streben, dass menschliche Arbeit – egal welche – Raum für Selbstverwirklichung, Kreativität und Sinnstiftung zulässt? Aus dem einfachen Grund, dass all diese Prinzipien einem menschlichen Grundbedürfnis entspringen und der Gesundheit zuträglich sind.
Zusammengefasst geht es also einerseits darum, auch künstlerische Arbeit „nur“ Arbeit sein zu lassen und andererseits, ihren als attraktiv empfundenen Eigenheiten auch in anderen Berufen und Beschäftigungen Raum zu geben. Das heißt also, es sollte überall möglich sein, das eigene Wesen zu entfalten und seine individuell gegebenen Möglichkeiten und Begabungen auszuschöpfen.
Weiterführende Web-Links zu diesem Thema:
Bettina Siegele und Andrei Siclodi, Die Kunst und das Prekariat (PDF) tinyurl.com/prekaritaet-01
Stephanie Hamader, Prekäre Arbeits- und Le- bensverhältnisse künstlerisch Erwerbstätiger (PDF) tinyurl.com/prekaritaet-02
Klaus Kraemer, Prekarität – was ist das? (PDF) tinyurl.com/prekaritaet-03