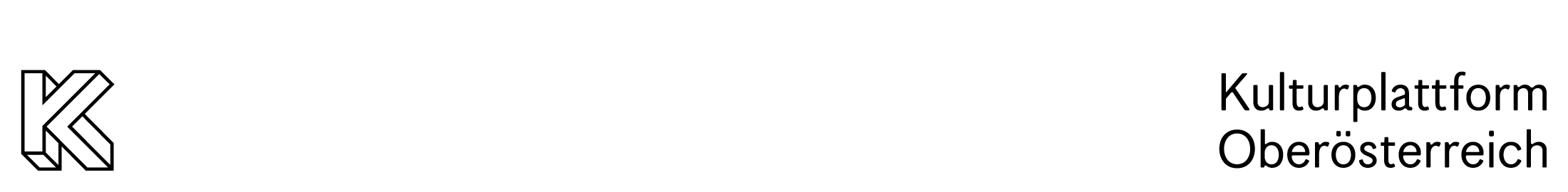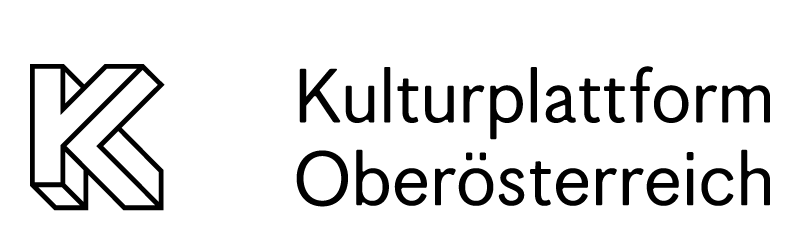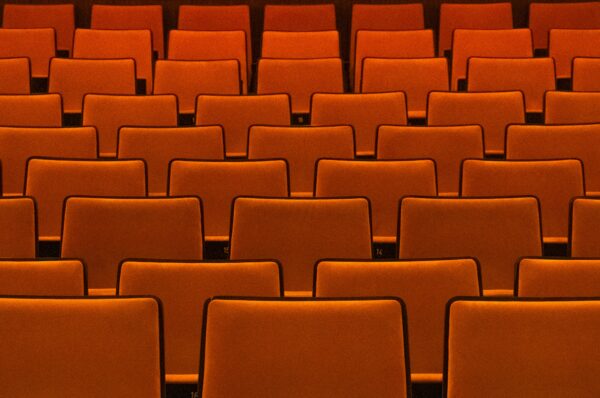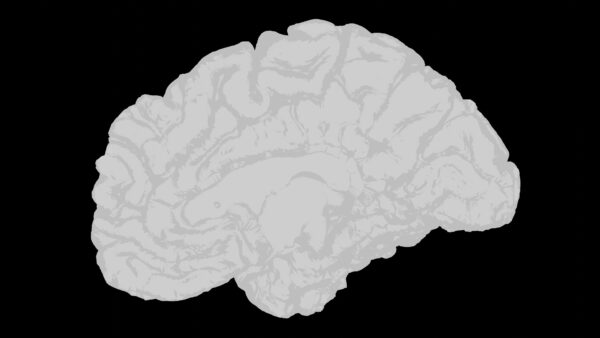Wir können Zukunft nur positiv gestalten, wenn wir aus Geschichte lernen. So weit so konsensfähig. Aber hätte die Vergangenheit auch anders ablaufen können? Und was bedeutet das für uns heute? Vermittler*innen am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim suchen nach zukunftsfähigen Fragen.
Wenn Geschichte vom Ende her erzählt wird, kann es leicht passieren, dass die Ereignisse als kausal verstanden werden, so als ob nur diese eine Entwicklung möglich gewesen wäre. Eine von zehn Guidelines des United States Holocaust Memorial Museums (USHMM) für Lehrer*innen lautet: «Vermitteln Sie nicht, dass der Holocaust unvermeidlich war. Nur weil ein historisches Ereignis stattgefunden hat und es in Lehrbüchern oder durch Filme dokumentiert ist, bedeutet dies nicht, dass es sich genau so ereignen musste.» (1)
Anfang – Ende – und weiter?
In Hartheim verortet eine umfangreiche Ausstellung Wert des Lebens den Nationalsozialismus, die Vorgeschichte und unterschiedliche Diskurse bis in die Gegenwart. Menschen in Gruppen einzuteilen, zu bewerten und auszugrenzen, etwa auf Grund ihrer psychischen Erkrankung, ihrer Arbeitsfähigkeit, die Idee vom ‹perfekten Menschen› – all das begann weder 1938 noch endete es 1945. Geschichtsschreibung orientierte sich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem an Regierenden und Jahreszahlen, an einer ‹Geschichte von oben›. Fragen, die uns und die Gegenwart betreffen, tauchten kaum auf. Bis heute werden sie zu wenig gestellt: Wie reagieren einzelne Akteur*innen in Dorfstrukturen, wenn sich das politische System ändert? Wie verhält sich das große Dorf, die Gesellschaft, vor, während und nach dem Nationalsozialismus? Welche Annahmen, Denkmuster und Fähigkeiten begleiten uns ungebrochen weiter? Haben sich die Strukturen unserer Gesellschaft – etwa Bildung, Arbeit, Soziales und Gemeinwesen – genug gewandelt? Wie diskutieren wir darüber?
Handlungsmöglichkeiten
«Der Holocaust fand statt, weil einzelne Menschen, Gruppen und Nationen die Entscheidung trafen zu handeln oder nicht zu handeln», heißt es weiter in der USHMM-Guideline. Demgegenüber stehen Aussagen von Schüler*innen, Lehrkräften und anderen Besucher*innen von Gedenkorten: «Die Leute wussten ja nichts» und / oder: «Die hatten ja alle Angst». Man nimmt an, die Gesellschaft sei per se dagegen und auf Seiten der Verfolgten gewesen. Und dass Angst das Handeln von Menschen automatisch dahingehend beeinflusst, nichts zu unternehmen. Der Mythos, ‹alle› wären Opfer gewesen, klingt 2019 weiter durch.
Um von dem Denken wegzukommen, ein kleiner Täter*innenkreis habe den Nationalsozialismus verantwortet, hat sich in der Wissenschaft der Begriff ‹bystander› entwickelt, der mit ‹Zuschauer*innen› oder ‹Mitläufer*innen› unzureichend ins Deutsche übersetzt wurde. Wir wissen von einigen, die wirtschaftlich profitierten, die etwa die Beschäftigten der Tötungsanstalten mit Brot, Eiern, Bier oder Tabak versorgten. Wir wissen von ganz wenigen, die Widerstand leisteten. Über die große Mehrheit liegen kaum Zeugnisse vor. Worin lag ihr Vorteil? Was ist mit jenen, die im Nationalsozialismus sozial aufsteigen konnten? Oder das System als emanzipatorisch erlebten, sich selbst als ermächtigt? Was ist mit jenen, die mit ihrem Nicht-Handeln Täter*innen in ihrem Tun bestätigten? Deren Leben sich deutlich verbesserte? Was mit jenen, die schlicht einverstanden waren? Widersprüche durchziehen die Biografien Einzelner. Aber wir wissen zu wenig, um ein allumfassendes Bild der Gesellschaft abzubilden. Die Wissenslücken füllen wir mit Annahmen und Vorstellungen – die wir kaum herausfordern.
Denken wir etwa die weit verbreitete Angst-Erzählung ausgehend von der lokalen Ebene durch: Die Dorfbewohner*innen hatten Angst vor dem Personal der Tötungsanstalt, dieses wiederum Angst vor der SS, die SS Angst vor Hitler und Hitler Angst vor sich selbst? Bezeichnend ist die Erkenntnis einer Schulklasse, die zum ersten Mal hörte, dass nicht alle Täter*innen verurteilt worden waren: «Die haben nach der NS-Zeit einfach gesagt, sie hätten Angst gehabt!»
Was hat es mit mir zu tun?
«Was können Einzelne denn schon tun? Man hat ja auch eine Verantwortung, die eigene Familie nicht hineinzuziehen», suchen Besucher*innen nach Argumenten und ignorieren, dass es eigentlich um die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Marginalisierten in der Gesellschaft und am Ende gegenüber sich selbst geht – nämlich auch darum, zumindest nicht mitzumachen, weil wir «dazu verdammt sind, mit uns selbst zusammenzuleben, was immer auch geschehen mag» (2).
Selbstbehauptung, Indifferenz, Profit, sozialer Aufstieg, Zustimmung? Wenn uns das Erklärungsmodell der ‹Angst› abhanden kommt, werden wir unruhig. Denn wir wissen plötzlich: Die Menschen damals waren nicht so anders als wir heute. Wenn wir jemanden aussprechen hören, dass damals nicht alles schlecht gewesen sei, wenden wir uns dann angewidert ab? Oder filtern wir heraus, wie das Regime und seine Politik möglicherweise von vielen erlebt wurde: als so vielversprechend und zukunftsträchtig, dass viele bereit waren, den Preis (den andere zahlten) in Kauf zu nehmen? Uns mit uns selbst und unserer Kapazität zu solchen Abwägungen auseinanderzusetzen, schmerzt, und lässt die Wunde offen, auf der das Angstpflaster so lange so gut geklebt hat. Keine Aussicht auf Heilung, auf ein Ende der Geschichte.
Kein Ende in Sicht
Das Betrachten von Geschichte ist nicht alternativlos, es ist veränderlich und veränderbar. Das zeigt z. B. Gertrud Haarers Feststellung: «Ich hätte vor 20 Jahren so nicht über meine Mutter reden können» (3). Wer davon ausgeht, dass sämtliche Fragen bereits beantwortet wären, verkennt, dass die Vergangenheit genauso komplex ist, wie wir selbst. Wir entdecken nicht nur weiterhin, wir bewerten auch ständig neu. Und das ist eine gute Übung für unsere Gegenwart, das ist der Stoff, aus dem offene, zukunftsfähige Gesellschaften sind.
Kritisches Denken praktizieren
Es ist herausfordernd, regelmäßig als Einzige*r auf verschiedene Handlungsmöglichkeiten hinzuweisen, gegen eine so stark etablierte Erzählung. Der Austausch im Projekt Nebenan, Schloss Hartheim sowie konkret die USHMM-Guidelines bestärken uns: «Der Fokus auf diese Entscheidungen ermöglicht Einsichten in die Geschichte und in die menschliche Natur. Dies kann dazu beitragen, dass Ihre Schüler*innen zu kritisch(er)en Denker*innen werden.» Wir suchen Antworten auf die Erzählung der Alternativlosigkeit – durch offene Fragen und die Auseinandersetzung mit Entscheidungsfindungsprozessen, Motivlagen und Verhaltensmustern, mit den Menschen und dem Menschlichen in der Geschichte. Vor allem aber: durch Modelle, wie diese Art der Auseinandersetzung eingeübt werden kann, wie gemeinsame Aushandlungsprozesse häufiger und geläufiger werden. Denn alleine wären wir zu rasch am Ende.
Quellen
(1) United States Holocaust Memorial Museum, Guidelines for Teaching about the Holocaust, online auf → ushmm.org (Übersetzung der Autor*innen).
(2) Hannah Arendt, Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?, Vortrag 1964/65, mit einem Essay von Marie Luise Knott, piper 2018, S. 35.
(3) Gabriele Dinsenbacher (Buch & Regie), Lebenslinien – Gertrud Haarer, Meine deutsche Mutter, BR 2017, online auf → youtube.com.
Schloss Hartheim, in der Nähe von Eferding in Oberösterreich, war eine Tötungsanstalt. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden hier mehr als 18.000 Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie etwa 12.000 KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter*innen in einer Gaskammer ermordet. Seit 2003 gibt es den Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, die Gedenkstätte zum Nationalsozialismus sowie die Ausstellung Wert des Lebens.
→ schloss-hartheim.at
Gabriele Kainberger, Alexander Kleiss, Christa Memersheimer, Wolfgang Schmutz und Tamara Imlinger sind u. a. pädagogische Vermittler*innen am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim und Teil des aktuellen Forschungsprojekts Nebenan, Schloss Hartheim das sich mit dem historischen Umfeld und der Rolle der Zivilbevölkerung beschäftigt.