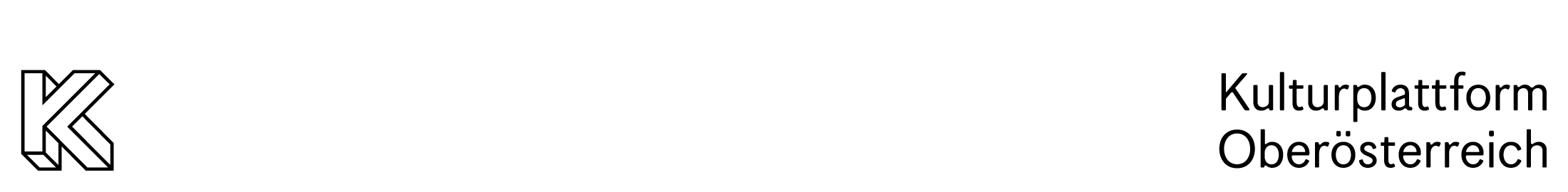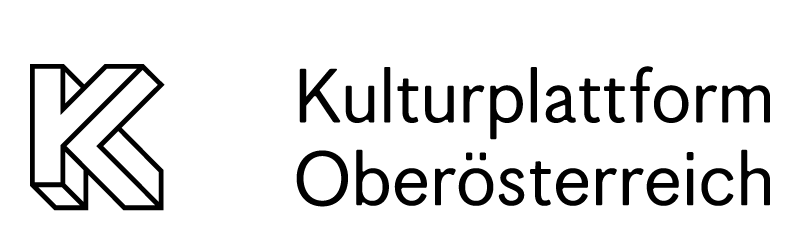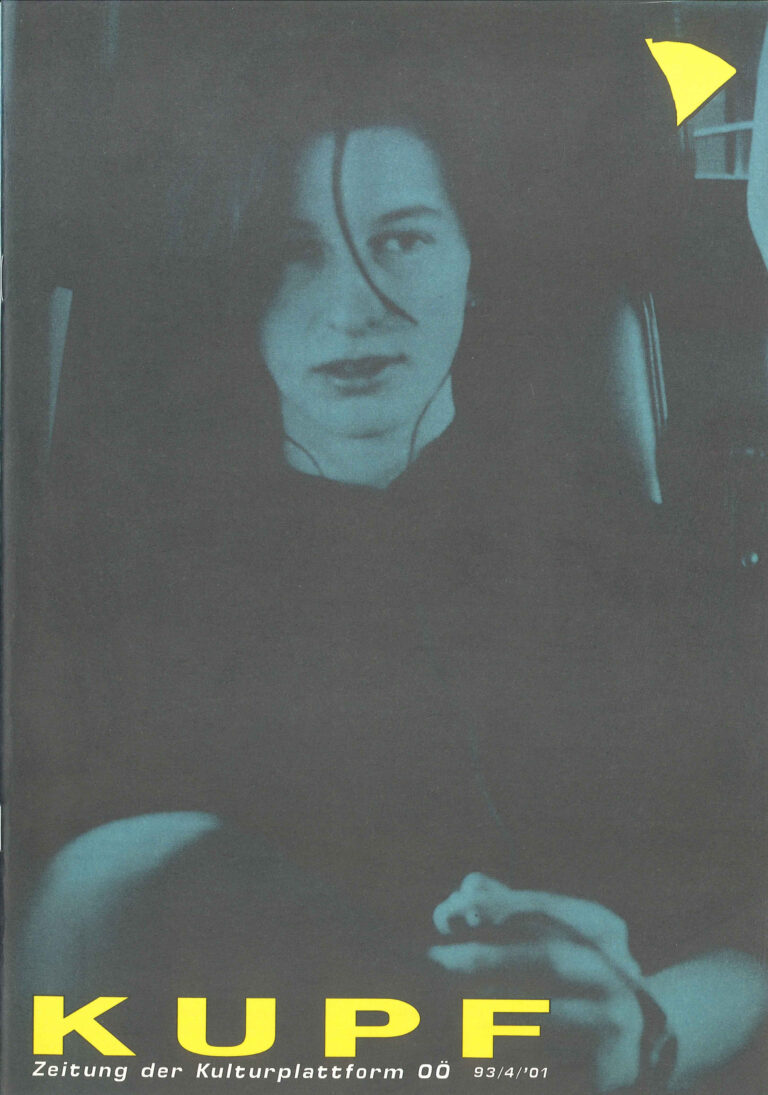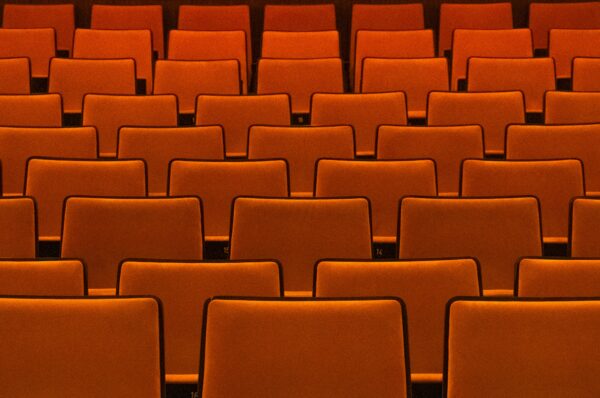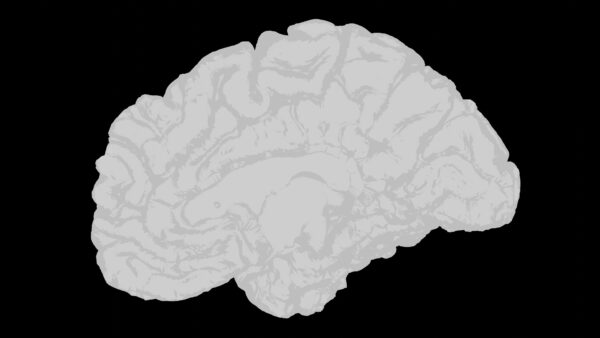Maren Richter verbrachte durch ein Auslandsstipendium sechs Monnate in Südafrika. Ein kurz Reflektion.
Sechs Monate abseits der „zivilisierten“ westlichen Welt. Eine kurze Reflexion von Maren Richter zum Trainée-Stipendium im nicht-westlichen (nicht-zivilisierten?) Johannesburg bei Camouflage/CCASA, von Jänner 2001 bis Juli 2001
Das bisher alle zwei Jahre ausgeschriebene Stipendium des BKA soll KulturarbeiterInnen die Chance geben, im Sinne einer Professionalisierung, im Ausland neue Qualifizierung im Kunst- und Kulturbereich zu erlangen. „Mit diesem Trainéeprogramm … bietet die Abteilung II/8 der Kunstsektion jungen KulturmanagerInnen die Möglichkeit drei bis sechs Monate „on the job“ Managementerfahrungen bei renommierten internationalen Kunst- und Kulturzentren zu sammeln.“
Schon bei den Bewerbungsunterlagen wird eine Art Katalog mitgeschickt, der einer Reihe von tatsächlich renommierten Institutionen wie das DIA Centre in New York usw. auflistet.
Es stellt sich aber damit gleich die Frage, welche Intention bzw. welchen konkreten Zweck „junge Kulturmanager“ mit diesem Stipendium verfolgen. Sind Managererfahrungen tatsächlich das einzige, was man im Ausland sammeln soll? Findet man allerdings im „Katalog“ kein passendes Aufgabengebiet, kann man Eigenvorschläge in die Bewerbung einbringen. In meinem Fall war es Südafrika/Johannesburg.
Die Entscheidung, in ein nicht-westliches Land (korrekter Weise heisst es „Dritte Welt-Land) gehen zu wollen, war vorerst eine „Bauchentscheidung“, gekoppelt mit einer vagen Vorstellung von dem von mir fokussierten Interessensrahmen. Warum wird in den letzten Jahren im institutionalisierten Kunstbetrieb so vehement versucht, sogenannte „identity through nationality“ Ausstellungskonzepte zu verfolgen – entgegen aller scheinbaren Auflösungsversuche nationaler Politik und transnationaler Gefüge?
Zynischerweise haben sich diese beiden „Trends“ im Kunstkontext in den letzen Jahren parallel entwickelt. Je mehr wir Hybridisierung, Heterogenität als Überwindung von nationalem Denken in der künstlerischen Praxis feststellen wollen, umso stärker weckt es das Bedürfnis, ein (neues, geografisch und kulturell weiter entferntes) Anderes in hübsch verpackten, leicht genießbaren Einheiten gegenüber zu stellen.
Afrika ist einer jener Kontinente, bei dem einerseits ein momentan gehyptes Interesse an einer zeitgenössischer Kunst zu orten ist. Gleichzeitig wird aber durch bemühte Versuche eine diffuse Transparenz suggeriert, die entweder bloß aufzeigt, dass künstlerisches Schaffen mit dem Zusatz „zeitgenössisch“ genau so funktioniert wie bei uns oder aber den Mythos des Fremden mehr aufrecht erhält, als dass sie diesen durchbricht. Weder das eine oder andere greift tatsächlich eine inhaltliche Debatte auf.
Oladélé Bamgboyé (ein in London lebender nigerianischer Künstler) sieht eine Entwicklung von einer institutionellen Oberflächenrahmungen zum dynamischen tieferen Diskurs daran scheitern, dass vom postkolonialen Künstler erwartet wird, sobald er das Andere ist, seine Arbeit diese stereotype Vorstellung von „otherness“ gleich selbst reflektieren sollte – und das innerhalb einer Praxis, die „Emanzipation“ als Fokus vorgibt. Es stellt sich also naheliegenderweise die Frage, was alternative Strategien zu jenen oberflächlichen easyreading-Konzepten sein könnten? Und wie diese vorort aussehen könnten?
Penetration of space
Die Institution Camouflage-Art.Culture.Politics in Johannesburg (zwar nicht „renommiert“ aber umso präziser arbeitend), in der ich 6 Monate war, wurde Ende 1999 gegründet.
Sie setzt ihre Arbeit in dem eben beschriebenen Setting an: Kunst und Kultur nicht zu einer leicht konsumierbaren Ware in einer globalisierten kulturellen Ökonomie zu machen, indem man sie als verfeinerte Version der postmodernen Strategie in ein europäisches oder amerikanisches Ausstellungssetting transferiert. Ihr Ziel ist vielmehr in der gegenübergestellten Analyse von Erster Welt und Dritter Welt, Postkolonialismus und Postmoderne, African Renaissance und „zivilisierter“ westlichen Demokratie, an strukturellen Ressourcen zu arbeiten. Vorerst in Form eines Raumes, einer Zeitschrift und einer Theory Edition.
Camouflage ist Teil einer größeren Institution CCASA – Centre for Contemporary Art of Southern Africa, die durch einen Pool an verschiedenen Personen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaft (KünstlerInnen, KuratorInnen, TheoretikerInnen) Konzepte entwickelt, die langfristig und intensiv an Inhalten arbeiten, vor allem im Bewusstsein, vorhandene westliche Strategien, wie die Konjunktur hybrider Mischwelten, in einen kritischen Kontext zu setzen und auch auf deren Gefahren hinzuweisen.
Die Versuche, ein Verständnis der soziopolitischen, kulturellen und theoretischen Komplexität des „jetzt“ zu bekommen, bestehen im Bewusstsein, dass die postkoloniale Debatte an Begriffen der kulturellen Differenz und der „ethnicity“ abgehandelt wird, d. h. hegemoniale und universalistische Strukturen verschwinden und werden von kulturellen und ökonomischen Differenzen, die nun grenz- und identitätsbestimmend auftreten, abgelöst.
Dadurch verschieben sich zwangsläufig die kulturellen und politischen Dringlichkeiten. Eine der sensitivsten Fragen ist beispielsweise „Wer darf wen repräsentieren?“, aber auch „Auf welche gemeinsame/eigene Vergangenheit kann/darf man zurückgreifen?“
„Wir haben keine kollektive Vergangenheit. Wir können jeden Tag eine neue behaupten und eine Sekunde später diese auch wieder zerstören. Das ist einerseits genial, andererseits beängstigend“ meint Stephen Hobbs/Trinity Session im Gespräch.
Für viele KünstlerInnen und TheoretikerInnen in Johannesburg ist „Creating a society with a spatial order“ ein Ansatz, um eine Diskussion über politische und gesellschaftliche Machtstrukturen zu initiieren. Im Fokus auf die südafrikanische Geschichte lässt sich die Politik der Macht als eine „politics of space“ (David Koloane/Begründer des Atelierhauses Bag Facory) ableiten (wohl am offensichtlichsten in der Ghettoisierung als Trennung des dort existierenden Europas von einer „Afrikanisierung „festzustellen). Dem zu Folge sind die Künstlerinnen auch weniger in den sogenannten White Cubes zu finden (die auch reihenweise schließen), sondern direkt auf der Straße und in der Community.
Leider ist hier nur eine Skizzierung des inhaltlichen Handlungsrahmens möglich. Eines ist offensichtlich, nämlich dass „inside“ und „outside“ bei weitem nicht die selbe Reflexion des postkolonialen „jetzt“ stattfindet. Für mich ist evident: Ein Auslandsstipendium kann eine Möglichkeit sein, den Fokus inhaltlich zu erweitern und exakter an der naheliegenden Frage zu arbeiten: Where do we go from here: Chaos or Community? Der Blick auf die europäische Migrationspolitik, Rassismus und kollektive Feindbilder (die, wie sich in den letzten Tagen zeigte, perfekt funktionieren, indem man die Bedrohung der gesamten zivilisierten westlichen Welt argumentiert), bestätigen diese Notwendigkeit.
Maren Richter