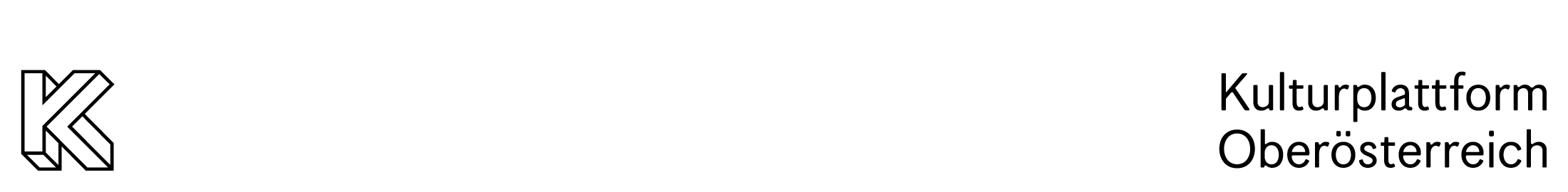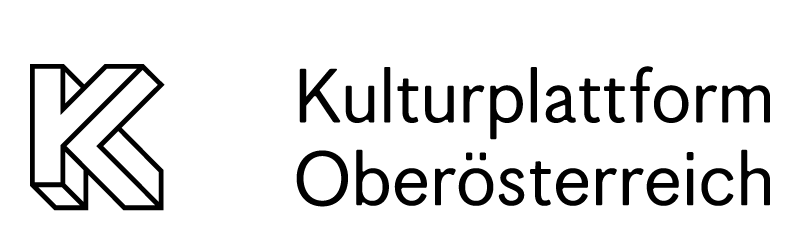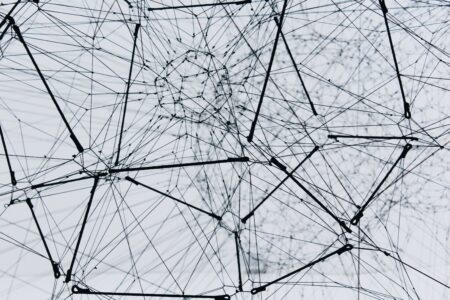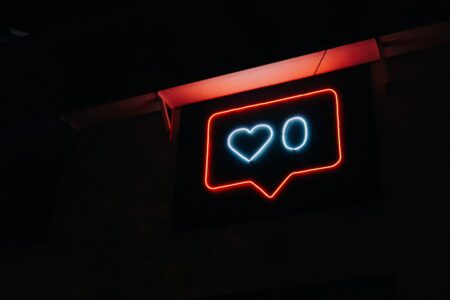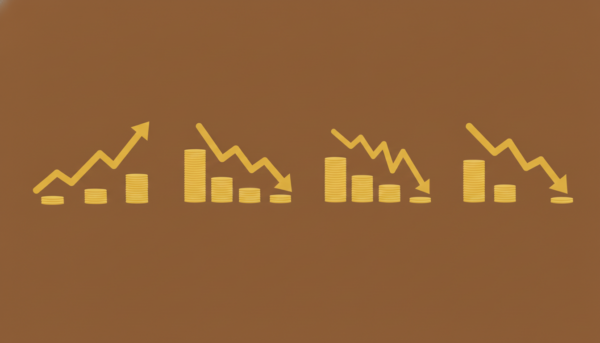Violetta Parisini reflektiert die Un_Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Kunst anhand ihrer eigenen Biografie.
Wenn wir über die Vereinbarkeit von Mutter*schaft und Musiker*innen-Sein nachdenken, müssen wir über Zeit, über Geld, über alte Rollenmuster und über Privilegien nachdenken. Ich schreibe über meine persönliche Geschichte, wissend, dass das Persönliche politisch und das Politische persönlich ist. Ich schreibe auch über Mütter*: Das Sternchen soll bezeichnen, dass es nicht nur um die Menschen gehen soll, die Kinder geboren haben, sondern um alle Betreuungspflichtigen von (kleinen) Kindern, idealerweise sogar um alle Care-Arbeiter*innen.
Rollenmuster und Sexismus
Ich stamme aus einem weißen Wiener Bildungshaushalt, habe gelernt, schnell und klug zu reden und mir als junge Frau nie die Frage gestellt, ob ich Sexismus ausgesetzt sei. Ich hatte Erfolg als DJ und Sängerin, später als Solo-Artist mit Major-Vertrag. Frau zu sein, nahm ich als Vorteil wahr. Ich fühlte mich durch und durch unabhängig. Ich war eine gute Verbündete des Patriarchats.
Dann wurde ich Mutter und ich realisierte, wie stark alte Rollenmuster unser Leben prägen, und wie schwierig es ist, sich aus ihnen zu befreien. Nachdem es in den ersten Jahren ein sehr persönlicher, psychischer und finanzieller Struggle war, Mutter zu sein, kam im Laufe der Jahre die Realisation, dass es eigentlich ein kollektiver ist. Immer noch werden arbeitende Mütter* gefragt, wer auf ihre Kinder aufpasst, während Väter*, die ihren Teil der Betreuungspflicht übernehmen, bestaunt werden als engagierte oder leicht verrückte Exoten. Das alles lässt sich mit Zahlen schön belegen: Frauen, die Kinder bekommen, gehen zu 95,4 % über 10 Monate lang in Karenz. Väter zu 7,6 % (Alexandra Zykonov, «wir sind doch alle längst gleichberechtigt!» – 25 Bullshitsätze und wie wir sie endlich zerlegen, 2022). Frauen, die Kinder kriegen, verdienen 70 % weniger als ihre kinderlosen Geschlechtsgenossinnen (Mareice Kaiser, Das Unwohlsein der modernen Mutter, 2021). Dass unsere Umgebung durch und durch sexistisch ist, wurde mir erst als Mutter schmerzlich bewusst.
Zeit und Geld
Auf vorher ungeahnte Weise schrumpfen Zeit und Geld, sobald man ein Kind in die Welt gesetzt hat. Nachdem ich in den ersten Jahren noch Konzerte gab, merkte ich nach der Geburt meines zweiten Kindes, dass ich mich verlangsamen muss, wenn ich als Mutter und als Künstlerin überleben will. Ich beschloss, mein Solo-Projekt (meine Haupteinnahmequelle) zu pausieren, ich hatte nichts mehr zu geben, alles, was ich aufbringen konnte, floss direkt in die Kinder. Ich konnte die Zeit der Bühnenpause, und auch die Zeit danach – bis zum heutigen Tag –, als Künstlerin nur überleben,
1. weil ich Geld geerbt habe. Erben ist eines der ungerechtesten Phänomene überhaupt; es ist in Österreich momentan nicht besteuert.
2. weil ich einen Mann habe, mit dem ich mir die Kosten unseres Lebens teile, und der seinen Teil der Kinderbetreuung übernimmt.
3. weil die Kinder räumlich nahe, engagierte Familienmitglieder haben, die ihnen Zeit und Liebe widmen. 4. weil ich 2021 das SKE-Jahresstipendium bekommen habe. Ein Stipendium, um das man nicht ansucht, sondern für das man von einer Jury nominiert wird. Für Recherche und Ansuchen hätte ich 2020 weder Zeit noch Nerven gehabt.
Dass ich inzwischen wieder auf Bühnen stehe und die Zeit hatte, mir neue Lieder auszudenken, wurde mir von all dem ermöglicht. Diese Ressourcen und Unterstützung sind große Privilegien, die viele nicht haben. Sie sind nicht selbstverständlich.
Mütter* in der Musik
Wir müssen also dringend etwas tun, um Mütter* in der Musiklandschaft zu halten. Man könnte z. B. ein bedingungsloses Grundeinkommen für Betreuungspflichtige bzw. Care-Arbeiter*innen einführen und sich andererseits um ein lückenloses und leistbares Kinderbetreuungsangebot kümmern. Inklusive gerecht bezahlter Betreuer*innen. Gerade kleinen Selbstständigen – und das sind fast alle freischaffenden Musiker*innen, die ich kenne – würde das ermöglichen, ohne existenzielle Nöte Kinder zu kriegen.
Bis das umgesetzt wird, braucht es ein niederschwelliges Stipendium für Musiker*innen, die Eltern geworden sind – z. B. vom Musikfonds –, wenn wir relevante Musik von dieser Bevölkerungsgruppe wollen. Und das will ich. Ich sehne mich nach Vorbildern, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.