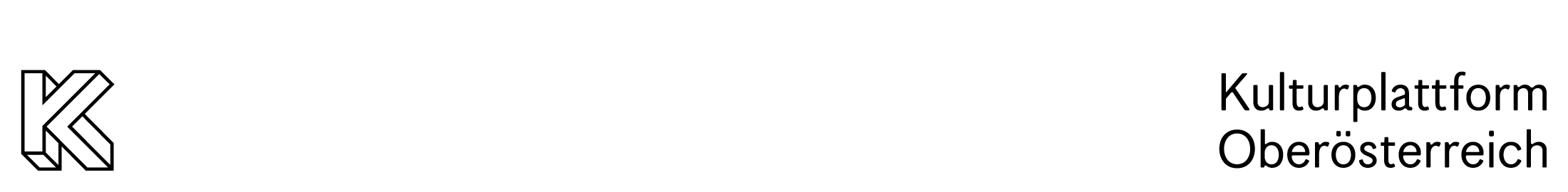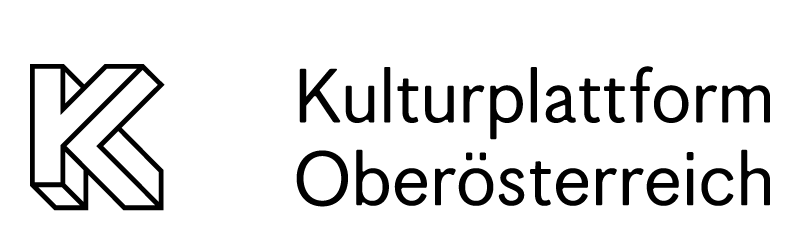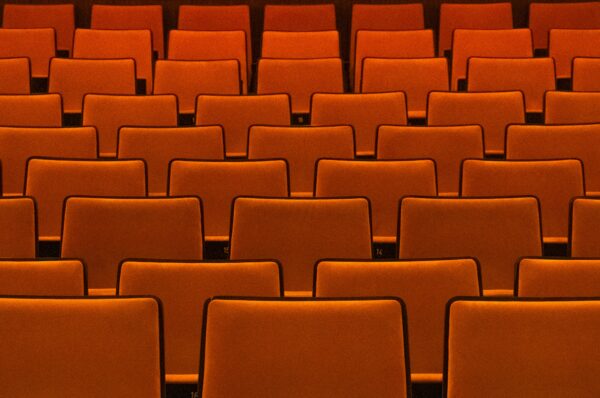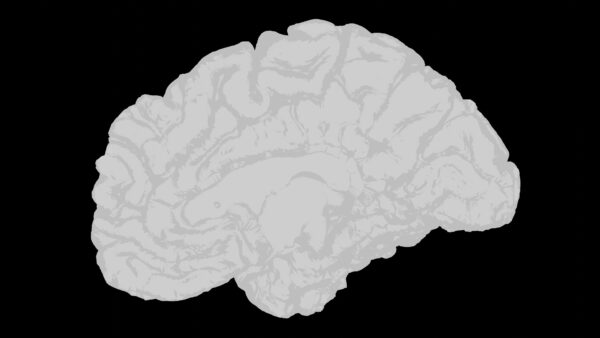Einen Streifzug durch das Lebenswerk von Pierre Bourdieu wagt Gerhard Fröhlich
Pierre Bourdieus dicker Wälzer (910 Seiten) über die „Feinen Unterschiede“ kam mir schon vor langer Zeit zu Gesicht – ein Kollege borgte ihn mir. Eng und kleingedruckt, voll schrecklicher Wortungetüme und Schachtelsätze über 1/4 Seiten, konnte er mich nicht dazu verführen, ihn ganz zu lesen, und schon gar nicht von vorne nach hinten.
Mühen der Kletterei, Gymnastik der Herrschaft. Doch beim Durchblättern fand ich Amüsantes: warum Fischessen nichts für französische Männer der Volksklasse sei, die was auf sich halten wollen (denn Fisch müsse man „weibisch“, nämlich vorsichtig mit den Vorderzähnen tastend, kauen – der Gräten wegen; zudem halte er nicht vor). Warum AufsteigerInnen oft so verschwitzt aussehen (man merke ihnen „die Mühen der Kletterei“ an). Die mitleidlose Beschreibung der KleinbürgerInnen (kleinbürgerlich-geschäftig sich klein machend, „um Bürger werden zu wollen“; Triebaufschub zugunsten fiktiver Belohnungen in fernen Zukünften) und die aufschlussreiche Enthüllung der Herrschaftstechniken der Oberschicht taten es mir an, und – in den 1980ern noch eine Rarität – viele aufregende Passagen über die Menschenkörper, aus konsequent soziologischer Sicht: Gesten der Unterwürfigkeit – für Bourdieu „Gymnastik der Herrschaft“, welche sich in unsere Körper, in unsere Psychen eingrabe; die eigentümliche Zufriedenheit der Oberschicht-Frauen mit ihrem Aussehen, und die chronische Unzufriedenheit der Mittelschicht-Frauen mit dem ihrigen – beides unabhängig von ‚objektiven‘ Kriterien bzw. den aktuellen Schönheitsidealen. Doch bei aller Unterhaltsamkeit wollte ich mich nicht mit den mühsamen Texten und Tabellen abplagen.
Diskurse und Strategien. Dann verschlug es mich in die Welt der akademischen Philosophie und Wissenschaftstheorie, in die kältesten Eiswüsten der Abstraktion: Begriff, Theorie, Gesetz. Logik, Rationalität. Schlagartig lernte ich Bourdieu zu schätzen: Dass für ihn etwa Wissenschaften nicht bloß abstrakte Aussagensysteme darstellen, sondern Felder, in denen – bei aller Beschwörung von „Wahrheitsstreben“ auf der Ebene der Diskurse, der schönen Sonntagsreden – auf der Ebene der Strategie mit allen Tricks gekämpft wird – auch mit Lobbying, Mobbing, Schimpfklatsch. Ähnlich im Kunstfeld bzw. im Raum kultureller Produktion und Dienstleistung.
Zweierlei Kulturschocks. Als kleiner Postbeamtensohn aus hinterster Provinz dank bester Prüfungsleistungen wurde Bourdieu unter arrogante Pariser OberschichtlerInnen katapultiert; im Krieg verschlug es ihn als Soldat nach Nordalgerien, unter die KabylInnen, welche sich gegenüber Kolonialisten (heute: gegenüber Militärs und islamische Fundamentalisten) erstaunlich resistent zeig(t)en. Bourdieus Konzepte sollen dort entstanden sein: Habitus (Haltung, Habe, Gehabe) und symbolisches Kapital: in vorindustriellen Gesellschaften geht es um Ehre, gleichwohl können wir von einer rationalen Ökonomie der Praxis sprechen: die Familienehre entspricht unserer Sozial-, Brandschaden- und Ernteausfallversicherung. Von Haus aus Philosoph, wandte sich Pierre Bourdieu nach seiner Rückkehr nach Frankreich der Bildungs-, dann der Kulturforschung zu. Noch später hat er – mit insgesamt ca. 200 MitarbeiterInnen – fast alle sozialen Felder untersucht: Reihenhäuser, Erzbischöfe, Literatur, Journalismus. Bloß Militärs und Neue Medien blieben ausgespart.
Kraft- und Kampffelder. Die (Gruppen von) AkteurInnen sind anhand ihrer relativen Stellung innerhalb der Felder definiert. Soziale Felder sind zugleich Kraft- und Konkurrenzfelder: Sie sind Magnet- oder Gravitationsfelder mit „unsichtbaren Beziehungen“. Ich halte das Bild der Gesellschaft und ihrer Subsysteme als Schwerkraftfelder für gelungen, es deutet die Mühe an, ‚gegen den Strom‘ zu schwimmen, emporzuklettern (deshalb das Verschwitzte der AufsteigerInnen), erklärt dies aber nicht für unmöglich. Die sozialen Felder sind auch Kampf- bzw. Konkurrenzfelder, auf denen um die Kräfteverhältnisse (inkl. Spielregeln) gerungen wird. Felder, Institutionen „brauchen“ handelnde Menschen, die das jeweilige Spiel ökonomisch und psychisch besetzen und in Gang halten. KonkurrentInnen sind KomplizInnen: Sie konstituieren gemeinsam Sinn, Bedeutung, Relevanz und Dynamik ihres Spiels.
Handlungsressourcen. In den einzelnen Feldern (wie Wirtschaft, Religion, Politik) sind unterschiedliche Kapitalsorten hoch im Kurs, d. h. unterschiedliche Handlungsressourcen wertvoll: neben dem ökonomischen Kapital Sozialkapital (Handlungsressourcen aufgrund der Teilhabe an Beziehungsnetzen), Kulturkapital – und zwar in unseren Körpern einverleibtes kulturelles Kapital (Wissen, praktische Fähigkeiten), in Büchern, Musikinstrumenten, technischen Geräten vergegenständlichtes kulturelles Kapital, und institutionalisiertes Kulturkapital (Bildungstitel). Crème der Crème ist das symbolische Kapital: Ehre, Prestige, Anerkennung, Reputation.
Warnung vor blinder Verständlichkeit. Was können wir mit diesen abstrakten Begriffen anfangen? Der Pädagoge Pestalozzi las deutschsprachigen Zöglingen französische Texte vor, um ihnen eine Vorstellung des „in der Wirklichkeit verborgenen Reichtums“ (Negt/Kluge) zu vermitteln. Alles wirklich Neue, in Konflikt mit unseren Wahrnehmungs- und Denkrastern, bereitet anfangs Kopfweh. Die Kopfschmerzen, die uns Bourdieu & CoautorInnen bereiten, lohnen sich – v. a. für AufsteigerInnen. Ihr Problem: Sie möchten von ihrem Herkunftsfeld (z. B. bäuerliches Mühlviertel) in ein angeseheneres oder lukrativeres (Uni, Kunstszene, höhere Wirtschaftsetagen) überwechseln, für das sie das erforderliche Kulturkapital und den passenden ‚Habitus‘ nicht mitbringen. Für FreundInnen der Computermetaphern: Der Habitus ist das ‚Betriebssystem‘, welches Kulturkapital, d. h. ‚Anwenderprogramme‘ (z. B. Klavierspielen) und ‚Daten‘ (Klaviernoten) benötigt – und ansprechende ‚Hardware‘ (=Körper in angesagten Idealformen). Ein feldfremder Habitus führt zu Unzufriedensein mit sich selbst (philosophisch verbrämt zur „Zerrissenheit des postmodernen Subjekts“), im Kampf mit dem Herkunftshabitus: gegen Sparsamkeit oder Ehrlichkeit (fatal in Feldern, in denen demonstrative Verschwendung und/oder Bluff angesagt sind, von Werbung bis Politik); Schüchternheit, Angst vor Blamage; lautpolterndes Lachen oder aufdringliches Schmatzen beim Essen und Küssen. So belegen die AufsteigerInnen sündteure Wochenendtrainings, z. B. von Fitness- und FarbberaterInnen oder von Neurolinguistischen Programmierern (NLP), die ihnen versprechen, sie rasch umzuprogrammieren.
Bildungsillusionismus. Bourdieu hält die Hoffnung, über Bildung gesellschaftliche Gleichheit zu erreichen, für illusionär. Der Weg vom „Titel“ zur „Stelle“ erfordere auch soziales („Vitamin B“) und ökonomisches Kapital. Drum gibt es keine arbeitslosen Oberschicht-Absolventinnen der Theaterwissenschaft: Hier kauft Papá eine Galerie in bester Innenstadtlage – mittels familiären ökonomischen Kapitals. Zur ersten Vernissage lädt er betuchte Geschäftsfreunde ein, Mamá bringt kultivierte Freundinnen mit (beides Spenden aus dem familiären Sozialkapital). Von zu Hause bringt die Tochter/der Sohn Kulturkapital mit, welches die Schule kaum vermitteln kann: Auftreten, Selbstsicherheit, Geschmack; charmant-respektgebietendes Lächeln; eine Stimme und Körpersprache, die auch effizient Ablehnung und Distanz in Form eisigster Höflichkeit ausdrücken kann. Und, fast hätte ich es vergessen: einen „guten Namen“, also Symbolkapital. So ausgestattet, floriert der Laden in Kürze.
Geselchtes Gehetztsein. Die Befunde der „Feinen Unterschiede“ stammen aus dem Frankreich der 1960er. Was Bourdieu und seine Leute damals über die französische Volksklasse herausgefunden haben, trifft z. T. auf die heutige österreichischen Landbevölkerung zu (wie der höhere Butter- und Fleischkonsum – um Freistadt gibt es die höchste Magenkrebsrate, ein Effekt des Verzehrs von viel zu viel Geselchtem; bloß der französische Hedonismus scheint eher der Raffgier gewichen zu sein), während vieles, was Bourdieu & Co den damaligen französischen KleinbürgerInnen zuschrieben (Schlankheitswahn, erbitterte Gymnastik, permanente Selbstbeobachtung und -kontrolle, ewiges Gehetztsein) auf das Gros unserer heutigen gehobeneren Mittelschicht-GroßstädterInnen zutrifft.
Wider die männliche Dominanz. Jahrzehnte bevor das amerikanische Wort „Gender“ (=“Geschlecht“) als Label aufkam, befasste sich Pierre Bourdieu bereits eingehend theoretisch mit der sozialen Konstruktion der Körper und der Geschlechter – und empirisch in Nordafrika wie in Frankreich. Doch Bourdieu weigerte sich, die sozialen Klassen zu leugnen und von Frauen an sich zu reden. Das nutze bloß den herrschenden Frauen; wir sollten weiterhin Arbeiterinnen bzw. Bäuerinnen, Kleinbürgerinnen, Oberschichtfrauen unterscheiden. Und wir sollten nicht vergessen: der ‚Feind‘ sitzt auch in uns – in den von uns tagtäglich erhaltenen Gefängnissen unserer Selbstzwänge (Norbert Elias), die wir mit uns mitschleppen, gekoppelt mit den resignativen (oder ehrgeizigen) Phrasen, die uns unsere Eltern eingetrichtert haben. Wir sollten die Deformationen in uns und in unseren Projekten nicht beschönigen, sondern illusionslos untersuchen – damit sie nicht hinter unseren Rücken wirken. Viele Erfahrungen von Frauen – Angst, Hemmungen, „fear of success“ (Angst vor Erfolg) – seien auch die vieler Männer unterdrückter Klassen. Wenn wir das Konzept der sozialen Konstruktion der Geschlechter ernstnehmen, können wir das soziale Geschlecht nicht einfach mit den biologischen Körpern fest verdrahten.
„Eine Art legitime Wut“. Einige Jahre vor seinem Tod hat sich Bourdieu von der „wissenschaftlichen Enthaltsamkeit“ abgewendet und sich eine „Art legitimer Wut“ gestattet. Sein Hauptgegner, den er für das „Elend der Welt“ verantwortlich machte: das amerikanische neoliberalistische Modell, das auf technokratische Entpolitisierung abziele, auf die Zurücknahme der europäischen sozialen Errungenschaften: „Es ist den Amerikanern gelungen, jeden Widerstand gegen ihre Herrschaft zu ersticken. Immer kommt sofort der Vorwurf des ‚Anti-Amerikanismus‘. Das löst einen Schuldkomplex … ganz besonders bei den deutschen Intellektuellen aus. … Die Intellektuellen und … jede europäische soziale Bewegung müssen sich von der Angst befreien, als anti-amerikanisch zu gelten, sobald auch nur die kleinste Kritik an einem Gesellschaftsmodell geäußert wird, das zu Recht mit den USA assoziiert wird. Dieses Gesellschaftsmodell trägt aggressive imperiale Züge, die offen zutage liegen.“
Gegen die stereotypen Phrasen vom „globalen Dorf“. Die Sprache ist nicht nur ein Medium der Kommunikation und Erkenntnis, sondern immer auch Instrument des Handelns und der Macht. Sprachen weisen Macht und Status zu. Herrschaft basiere nicht nur auf Gewalt und Ökonomie, sondern auch auf Sprachen: „Die zentralen Fragen, nicht nur in der Wirtschaftspolitik, auch in der Wissenschaft, werden heute in Englisch diskutiert, mit Begriffen, die oft erst gar nicht übersetzt werden. … Wenn man „globalization“ sagt, ist man up to date … Die Dominanz des amerikanischen Modells wird … auch durch die Sprache gesichert. Sie zementiert Denkstrukturen, führt Wahrnehmungsmuster ein, Sprache ist Herrschaft. Unter diesem Blickwinkel erscheint das Englische nicht mehr nur als harmlose Verkehrssprache, sondern als Instrument der Herrschaft durch Bilder und Begriffe, ganz ähnlich wie der Dollar im Bereich der Finanzen. Die Vorherrschaft der USA basiert .. (auch) auf der Durchsetzungsfähigkeit ihrer Sprache und Begrifflichkeit.“ Hier liege die besondere Verantwortung der Intellektuellen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen: „Wir hören den lieben langen Tag stereotype Phrasen. Man kann das Radio nicht anschalten, ohne dass vom „globalen Dorf“, von „Globalisierung“ usw. die Rede ist. Das sind Begriffe, die nach nichts aussehen, die aber eine ganze Philosophie im Schlepptau führen, eine ganze Weltsicht, welche Fatalismus und Schicksalsergebenheit erzeugt.“ Wir sollten die „Autoritätseffekte“ dieser Phrasen bekämpfen – „damit wenigstens der Anschein von Einstimmigkeit durchbrochen wird, der das wesentliche Element der symbolischen Stärke des herrschenden Diskurses ausmacht.“
Soziale = kulturelle Errungenschaften. „Soziale Schutzrechte …, … die verschiedenen sozialen Errungenschaften gehören genauso zur europäischen Kultur wie etwa Goethe.“ Sie „… sind nicht minder hochrangige und wertvolle Errungenschaften, die … nicht nur in Museen, Bibliotheken und Akademien fortexistieren, sondern im Leben der Menschen selbst lebendig und wirksam bleiben.“ Bourdieu plädiert für eine „echte Ökonomie des Glücks, … die allein in der Lage ist, allen symbolischen und materiellen Gewinnen und Kosten, die aus menschlichem Verhalten … entstehen, Rechnung zu tragen.“ Zu ihrer Durchsetzung müssten wir die nach wie vor (gerade auch bei Gewerkschaften und Oppositionsgruppen) bestehende „Dominanz des nationalen Horizonts“ überwinden und neue supranationale Allianzen bilden.
Selbstreflexion und Zivilcourage. Doch Bourdieu erlaubt es nicht, dass wir uns angenehm-ohnmächtig zurücklehnen: Wir dürfen uns selbst aus der schonungslos kritischen Analyse nicht ausnehmen. Pierre Bourdieu fordert von uns Zivilcourage im eigenen Alltag: Wir sollten dort verantwortlich sein, wo wir Freiheiten haben, und uns „beharrlich all der winzigen Nachlässigkeiten verweigern, die der gesellschaftlichen Notwendigkeit ihre Wirksamkeit belassen“; wir sollten unsere „opportunistische Gleichgültigkeit sowie den aus Enttäuschung geborenen Konformismus bekämpfen, die der sozialen Welt geben, was diese Welt verlangt“. Wir sollten den Mut aufbringen, „die vielen kleinen Nichtigkeiten resignierter Gefälligkeit und unterwürfiger Komplizenschaft“ zu unterlassen.
Gerhard Fröhlich
„Soziale Errungenschaften sind kulturelle Errungenschaften, wie Goethe und Beethoven“ Pierre Bourdieu, 1930 – 2002.