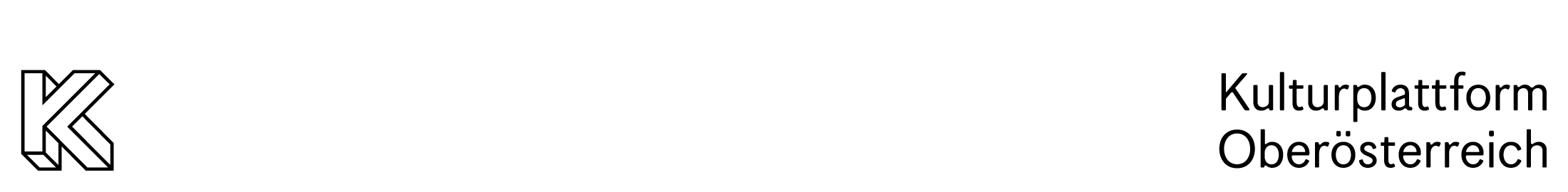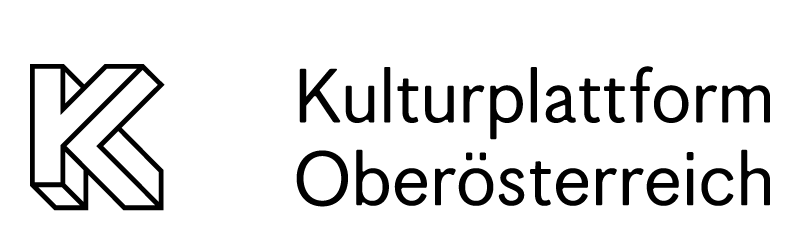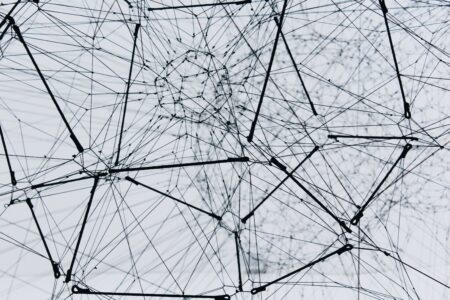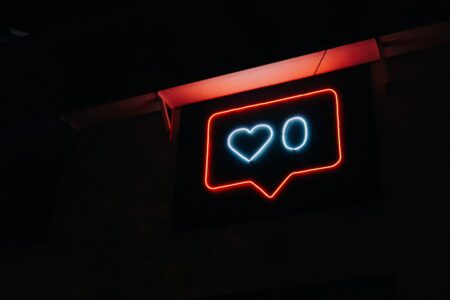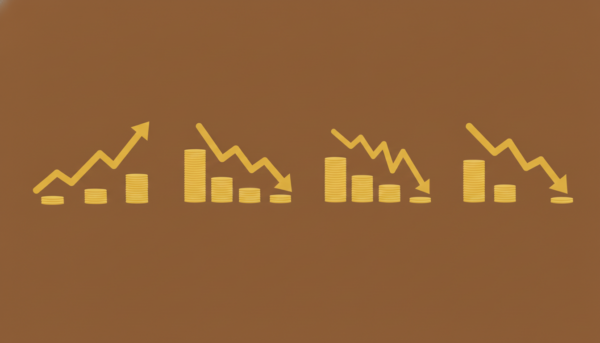Lisa-Viktoria Niederberger gibt Einblick in den Alltag im Kunst- und Kulturbereich, wenn man von Depression betroffen ist.
Der Kulturbetrieb lebt von Abendveranstaltungen. Als Autorin und Kulturarbeiterin mit Depressionen fand ich das immer schon furchtbar. Richtig schlimm wurde es aber, als ich vor anderthalb Jahren mit dem Trinken aufhörte und lernte, wie hektisch, laut, hell und herausfordernd Lesungen etc. ohne die Unterstützung von Weißem Spritzer sind. Depressionen machen eine*n zwangsläufig phasenweise zur Eremit*in, arbeitsbedingte Abendtermine fordern Anwesenheit, ob man will und sich bereit fühlt, oder nicht. Abends performen zu müssen, ist besonders in psychisch dunklen Zeiten schwer, weil genau dann Aktivität gefordert wird, wenn der Tag normalerweise als überstanden gilt. Abzusagen ist keine Option, nicht vereinbar mit der ohnehin prekären Einkommenssituation als Künstlerin. Ich habe mich also schon viele Male aus dem Bett und aus der Gammelhose in den Bühnenblazer gequält. Sobald ich dann mit meinem Wasserglas und meinem Text auf dem kleinen Tisch im Scheinwerferlicht sitze, trage ich eine Rüstung aus Professionalität, die ich mir hart antrainiert habe. Meinem Lächeln sieht man nicht an, wie sehr ich mich zum Zähneputzen und Abendessen zwingen musste, meinen Haaren nicht, wie schwer es mir manchmal fällt, sie zu waschen. Und obwohl ich der tiefen Überzeugung bin, dass mein Text oder meine Statements bei der Podiumsdiskussion das Allerletzte sind (weil ich das Allerletzte bin, danke Depression), bleibe ich für Fotos, freue ich mich, wenn jemand ein Buch signiert haben möchte.
Was nicht geht
Man kann mich als hochfunktional depressiv kategorisieren, aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Dass ich am Tag nach Lesungen bis mindestens Mittag im Bett liegen muss, weil mein sozialer Akku komplett leer ist, wussten vor diesem Artikel nur mein Partner und meine Therapeutin. Warum erzähle ich es jetzt? Weil ökonomische Ängste einer der zentralen Auslöser von Depressionen sind, und uns das, insbesondere in der angeschlagenen postpandemischen Freien Szene alle betrifft. Weil es nur eine unzureichende Krankenstandsregelung für niedrigverdienende Selbstständige gibt und weil es Künstler*innen und Veranstaltenden obliegt, eine Lösung für krankheitsbedingte Ausfälle zu finden. Derzeit sieht das so aus: Ach, du trittst doch nicht auf? Schade, kein Geld für dich! (Zwischen den Zeilen: Kannst froh sein, wenn du noch einmal eingeladen wirst.) Also gehen wir zu oft (psychisch) krank arbeiten, mangels Alternativen. Vielleicht machen wir es uns ein bisschen leichter: Bier, zweites Bier, Joint, Notfalltablette. Und wenn’s wirklich mal nicht geht, dann lügen wir. Ich habe zumindest bisher immer gelogen, wenn ich depressionsbedingt nicht arbeiten konnte, eine Migräneattacke vorgeschoben, in feministischen Kreisen auch mal die Menstruation. Als im Patriarchat sozialisierte Frau habe ich immer noch Bedenken, als hysterisch oder Ähnliches abgestempelt zu werden, wenn ich ehrlich sagen würde, wie schlecht es mir manchmal geht. Und als Selbstständige im Neoliberalismus habe ich keine Lust auf den tausendsten «Du musst aber schon durchbeißen, wenn du es zu etwas bringen möchtest»-Vortrag, der dann oft kommt.
Wie es gehen könnte
Ich wünsche mir eine Lösung für die Vereinbarkeit von chronischer Krankheit und dem Arbeitsleben im Kulturbetrieb. Dass ehrliche Dialoge, die Verletzbarkeit erlauben, unter betroffenen Kolleg*innen und Veranstalter*innen nicht bloß schöne, solidarisierende Ausnahmen bleiben, sondern normalisiert werden. Ich bin nicht meine Depression, aber an vielen Tagen bestimmt sie, wie meine Tage aussehen. Ich möchte sie nicht wie ein Label oder Statement vor mir hertragen, sie aber auch nicht verstecken müssen.
So beginnt für mich der Lösungsweg: bei Transparenz, bei ungeschönter Ehrlichkeit. Ich werde mangels Alternativen vermutlich noch lange nicht aufhören, mich auch an dunkeldunkelgrauen Tagen zu Abendveranstaltungen zu zwingen, aber vielleicht könnte ich in Zukunft offen sagen, wie es mir geht. Mindestens hinter der Bühne, wenn es passt, vielleicht sogar auf ihr.
Aber wir wissen alle, strukturelle Probleme kann man rein auf der individuellen Ebene nicht lösen. Fix ist: Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder in einer Gesellschaft, die psychische Krankheiten vorbehaltlos anerkennt, hätte ich diesen Essay ganz anders oder gar nicht geschrieben.