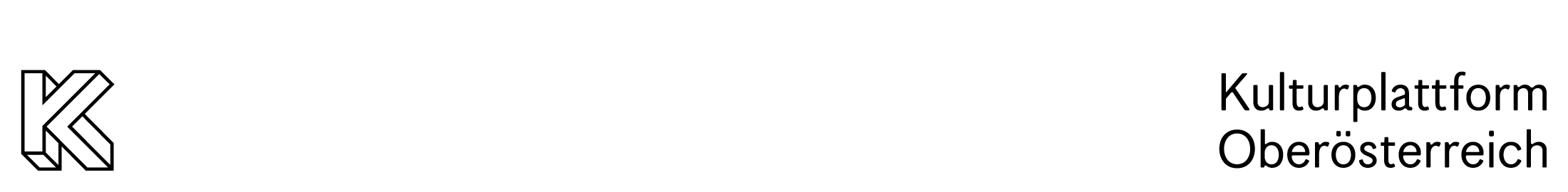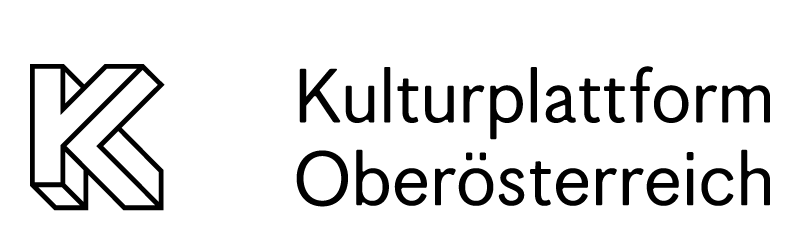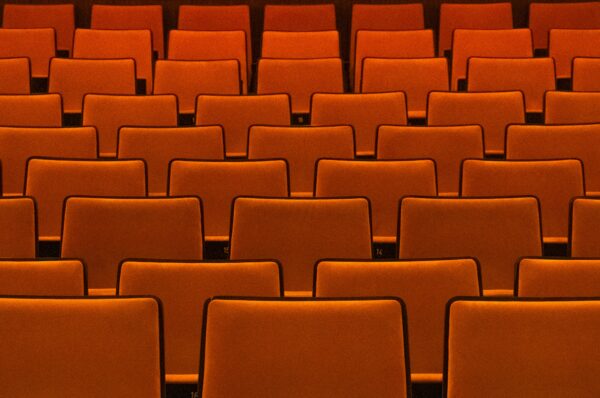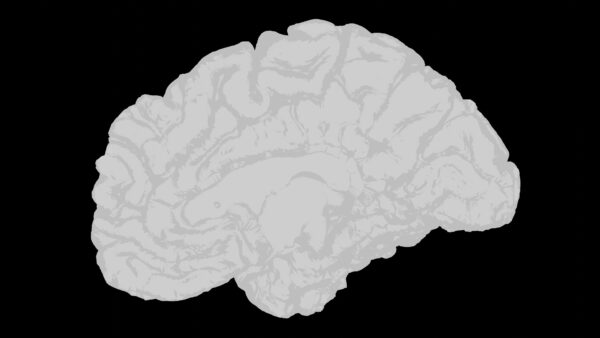Was müssen KulturarbeiterInnen und Kulturorganisationen selbst tun, um ihre Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln?
Dieser Text war Grundlage für einen Vortrag im Rahmen der KUPF-Klausur am 29. 9. 2000 von Günter Marchner
Wenn heute von „Kulturarbeit“ oder von „Kulturinitiativen“ die Rede ist, wird in erster Linie von ihrer Gefährdung durch die Sparmaßnahmen der Regierung und von der ideologischen und politischen Feindschaft, im Besonderen seitens der FPÖ, gesprochen. Kulturinitiativen verstehen sich als natürliche Gegner von Blauschwarz und als Teil einer Zivilgesellschaft, die den Widerstand gegen die Regierungspolitik organisiert. Alles scheint offensichtlich, der Feind ist klar und die Forderungen auch: Wir leisten gesellschaftlich wertvolle Arbeit, der Staat soll sie bezahlen usw..
Ich möchte aber im Gegensatz dazu jene Themen benennen, die in der Kulturszene vordergründig kaum diskutiert werden, die aber nachhaltig die Situation von Personen, Organisationen und Verbänden beeinflussen, die Kulturarbeit leisten. Sie betreffen nur teilweise die Sparmaßnahmen oder politische Feinde, sondern die Frage:
Was können und sollen KulturarbeiterInnen und Kulturorganisationen Ð jenseits von den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen Ð selbst tun, um ihre Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln?
Meine Thesen
These 1: Es kommt in der Kulturarbeit nicht nur auf die Höhe der öffentlichen Mittel und auf gute politische Rahmenbedingungen an, sondern auch darauf, wie gearbeitet wird (Qualität, Professionalität). Kulturarbeit ist auf Reflexionsfähigkeit und Professionalität angewiesen.
These 2: Kulturorganisationen müssen aus ihren Erfahrungen im Umgang mit Organisationsstrukturen lernen. Einerseits gibt es normale Alterungsprozesse von Organisationen, andererseits Erfahrungen und Probleme, die für Kulturorganisationen typisch sind. Für Kulturorganisationen wird es überlebensnotwendig, Erfahrungen und Probleme zu reflektieren und daraus Konsequenzen zu ziehen.
These 3: Kulturorganisationen und der gesamte neue kulturelle Sektor müssen ihr Selbstverständnis reformulieren und neue Strategien zur Sicherung ihrer Zukunft entwickeln. Sonst bleiben die Angebote, Qualitäten und Strukturen das Projekt einer Generation und sie werden verschwinden.
Diese Thesen betreffen natürlich im Besonderen FunktionärInnen von Verbänden und beruflich Tätige in Kultureinrichtungen. Im Folgenden möchte ich diese Thesen erläutern und begründen. Einerseits benenne ich bisherige Entwicklungen, die ich beobachtet habe. Andererseits möchte ich Schlussfolgerungen und Konsequenzen nennen, die sich meines Erachtens daraus ergeben.
Was ist Kulturarbeit?
Was ist sie nicht?
Wenn jemand fragt, was Kulturarbeit ist, wird es immer verschiedene Antworten geben. Das liegt an der Weite und Schwammigkeit dieses Begriffs sowie an unterschiedlichen Zugängen. Da in Kultureinrichtungen sowohl Männer und Frauen tätig sind als auch unterschiedliche „Typen“ wie zum Beispiel ManagerInnen, PädagogInnen, KünstlerInnen, MacherInnen, NetworkerInnen oder Technikfreaks, werden auch die Vorstellungen über Inhalte und Aufgaben von Kulturarbeit und über das „Programm“ von Kultureinrichtungen unterschiedlich ausfallen Ð je nachdem wer sich durchsetzt. Trotzdem möchte ich diesen Begriff eingrenzen: Kulturarbeit ist auf alle Fälle nicht auf die „Organisation“ von Veranstaltungen und auf „Vermittlung“ zu reduzieren. Schon gar nicht ist sie mit Kunstproduktion gleichzusetzen (obwohl KünstlerInnen natürlich auch Kulturarbeit betreiben können). Diese Verwirrungen haben mit Ungenauigkeiten zu tun. Permanent werden „Kunst“ und „Kultur“ verwechselt bzw. gleichgesetzt. Die öffentliche, mediale und politische Wahrnehmung setzt Kulturarbeit allzu rasch mit der Herstellung eines bunten Veranstaltungsangebotes gleich.
Ich möchte daher einige Elemente hervorheben, die meines Erachtens Kulturarbeit ausmachen:
- Kulturarbeit hat ein Selbstverständnis: Sie ist mit politischem und sozialem Engagement verbunden und hinterfragt Machtverhältnisse und Traditionen.
- Kulturarbeit bezieht sich auf Lebensweisen, Wertvorstellungen und Utopien (siehe der alte Slogan der 70er/80er Jahre: Wie wollen wir leben und arbeiten?).
- Kulturarbeit hat emanzipatorische Ziele (Aufklärung, Bewusstseinsbildung, Veränderung).
- Kulturarbeit versteht sich als Intervention: Sie soll etwas in Bewegung bringen, Impulse setzen, aktivieren usw..
- Kulturarbeit findet in verschiedenen Bereichen und Orten statt: Nicht nur im Kulturzentrum, sondern ebenso in der Jugendarbeit, in der Museumsarbeit, in der Erwachsenenbildung oder in der Gemeindeentwicklung.
- Kulturarbeit findet in unterschiedlichen Formen statt: als Tätigkeit von EinzelkämpferInnen oder im Rahmen von neuen und etablierten Einrichtungen (von autonomen Kulturinitiativen bis hin zu Volkshochschulen).
Mein Fazit daraus lautet: Der Begriff von „Kultur“ und das Feld von Kulturarbeit ist sehr weit. Die Grenze zu Sozialem und zur Politik verschwimmt. Kulturarbeit hat mindestens mit der „Herstellung eines kreativen Klimas“ (Gerhild Trübswasser, KUPF ??? 2000) und mit der Schaffung von „Möglichkeitsräumen“ zu tun. Kulturarbeit „macht“ nicht, sondern sie fördert: Sie gestaltet Rahmenbedingungen, sie schafft Möglichkeiten, damit bestimmte Aktivitäten und Prozesse Ð von Lernerfahrungen, Gruppenprojekten bis hin zu qualitätsvollen Ereignissen – geschehen können. Sie ist weniger eine punktuelle Angelegenheit als ein kontinuierlicher Prozess.
Typische Entwicklungen in der Kulturszene
„Fallen“ der Kulturarbeit:
Überforderung: Von Kulturarbeit wird Ð von innen wie von außen Ð etwas erwartet. Sie soll etwas bewirken, bewegen, ermöglichen und verändern. KulturarbeiterInnen können dabei mit falschen bzw. überzogenen Ansprüchen konfrontiert werden. Es gibt auch hier die Erfahrung des „Burn-Out“. Druck und Überforderung haben damit zu tun, dass man zu wenig über Ziele, Rollen und Aufgaben nachdenkt und Klarheit schafft.
Schrebergarten: Aufgrund unklarer Vereinbarungen und Ziele und falsch verstandener Autonomieansprüche besteht die Gefahr, dass „Spielwiesen“ und „Schrebergärten“ entstehen. Projekte werden gemacht, ohne dass Ziele, Ergebnisse, Zielgruppen Ð und vor allem Qualitäten und Ergebnisse festgelegt werden. Wenn nie jemand danach fragt, wird Kulturarbeit rasch zur unhinterfragten Spielwiese persönlicher Interessen und Vorlieben.
Beschränkung auf „Herzeigbares“ und „Sichtbares“: Wenn Ziele wie zum Beispiel das Ermöglichen kreativer Prozesse aus dem Blick geraten, beschränkt man sich rasch auf Herzeigbares und auf Gefragtes, auf Veranstaltungsorganisation und auf „Programm machen“. Dann fallen prozessorientierte Kulturprojekte wie z.B. Schreibwerkstätten von Frauen nicht auf, weil sie unspektakulär sind. Fehlende Konzepte im Bereich der Kulturarbeit machen anfällig für Interessen von FördergeberInnen und jenen, die am lautesten schreien, weil man ihnen nichts entgegenhalten kann.
Prekäre Rahmenbedingungen: Prekäre Arbeitsbedingungen aufgrund zu geringer, unregelmäßiger und fehlender mittel- bis langfristig gesicherter Mittel prägen die Erfahrungen in der Kulturarbeit. Für Berufstätige im Bereich der Kulturarbeit fehlen Zukunftsperspektiven (Karriereplanung, Umstiegsmöglichkeiten, Anerkennung von Qualifikationen über den eigenen Sektor hinaus), wie sie in anderen Bereichen üblich sind.
Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, Angestellten und FunktionärInnen: Die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, Angestellten und FunktionärInnen im Rahmen von Kulturorganisationen ist schwierig, aber notwendig. Notwendig ist sie, weil sie konstitutiver Bestandteil von Engagement und Initiative ist. Diese Zusammenarbeit stellt eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar. Je größer und professioneller Kulturorganisationen sind, desto rascher opfern sie diese Zusammenarbeit einer professionell funktionierenden Programmmaschine.
Generationenwechsel, neue Bedürfnisse und Zielgruppen: Angestellte und FunktionärInnen werden, gemeinsam mit ihrem Publikum bzw. den Vereinsmitgliedern älter. Der Anspruch einer ehemaligen schwungvollen alternativen Jugendkultur kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Kulturinitiativen müssen sich neu orientieren, um nicht „alt“ auszusehen. Dies hat Konsequenzen in Bezug auf ihre Zielgruppen, Inhalte, Schwerpunkte, Arbeitsweisen, ihre Organisationsstruktur und letztlich auf ihr Selbstverständnis. Kulturinitiativen erleben in dieser Hinsicht ähnliche Probleme wie traditionelle Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Volkskultur.
Der Widerspruch zwischen demokratischem Anspruch und der „Realverfassung“ in Kulturorganisationen: Alternative Organisationen sind mit typischen Problemen konfrontiert. Ein umfassender Demokratieanspruch wird zur Ausrede für Unklarheit und Entscheidungsunfähigkeit. Aufgaben, Kompetenzen, Funktionen, Rollen werden nicht klar festgelegt. Worüber wie und von wem entschieden werden soll, bleibt offen. Es wird viel diskutiert, aber Entscheidungen werden nicht getroffen Ð und wenn, dann von den informellen MachtträgerInnen. So entstehen Frustration über mangelnde Gestaltbarkeit und Veränderbarkeit auf der einen Seite und die Zementierung informeller Machthierarchien auf der anderen Seite.
Die gegenwärtige Situation des neuen kulturellen Sektors
Entwicklung eines neuen Sektors: Seit den 80er Jahren hat sich der sogenannte „neue kulturelle Sektor“ entwickelt und (wenn auch prekär) etabliert. Es gibt neue Arbeitsplätze, Berufsbilder, neue Angebote. Dieser Bereich erfüllt spezifische Leistungen und Funktionen, die aus diesem Grund auch öffentlich finanziert werden. Dieser Bereich ist durch eine Mischung charakterisiert, wie sie für den gemeinnützigen bzw. Non-Profit-Bereich im allgemeinen existiert: Es wird sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Arbeit geleistet. Es gibt sowohl private als auch öffentliche Finanzierung.
Der Staat als Förderer der Kulturinitiativen: Die öffentliche Finanzierung beruht auf Grundsätzen und Bekenntnissen Ð vor allem der sozialdemokratischen Kulturpolitik Ð seit den 70er Jahren: Bildung und Kultur sollen für alle da sein. Der Staat unterstützt gesellschaftliche Aufbruchsbewegungen. Der gute „josefinische“ Onkel (in Form von BeamtInnen und PolitikerInnen) ist zuständig für Engagement, Initiative und gesellschaftliche Aufbrüche Ð nicht die „Civil Society“. Er fördert nicht-kommerzielle gesellschafts- und demokratiepolitisch als wertvoll erkannte Initiativen und Projekte Ð als Aufklärung von oben aus dem Ermessensbereich. Kulturinitiativen haben ein durchaus typisch österreichisches Selbstverständnis: Einerseits halten sie sich aus der Tradition der Alternativbewegung und der neuen sozialen Bewegungen kommend für autonom. Andererseits halten sie es für selbstverständlich, dass der Staat die erste Adresse für die Finanzierung ihrer Aktivitäten ist.
Der Wandel zum neoliberalen Wettbewerbsstaat und seine Auswirkungen: Vordergründig sind Sparmaßnahmen und eine Partei wie die FPÖ ein Problem. Gleichzeitig sind die Sparmaßnahmen aber Ausdruck eines Strukturwandels und eines veränderten Zeitgeistes Ð dem auch die SPÖ seit vielen Jahren entsprochen hat. Das Problem sind die wirtschaftliche Liberalisierung der österreichischen Gesellschaft und die damit verbundenen Auswirkungen auf Politik und die Rolle des Staates. Was wird zukünftig als Aufgabe der Politik und von öffentlicher Finanzierung gesehen? Hat im neoliberalen Wettbewerbsstaat die öffentliche Finanzierung für gemeinnützige und kulturelle Tätigkeiten einen Platz? Beschränkt man sich auf die „wesentlichen“ staatstragenden Einrichtungen und Events und verzichtet man auf die Vielzahl kleiner und mittlerer Kultureinrichtungen?
Das Dilemma des neuen kulturellen Sektors: Ganz egal welche Regierungen wir haben werden: Die gewohnte Rolle des Staates (als Aufklärer, Unterstützer und Garant für ein Kulturangebot) sieht ziemlich alt aus. In Österreich scheint derzeit ziemliche Verwirrung darüber zu herrschen, dass das Gewohnte in die Defensive geraten ist und neue Perspektiven (noch) nicht in Sicht sind. Daraus ergeben sich folgende Probleme für den neuen kulturellen Sektor: Einerseits wird öffentliche Finanzierung von Kultur zunehmend in Frage gestellt. Das alte Selbstverständnis, dass der Staat und die „richtige“, gut meinende Politik für die Finanzierung von Kulturarbeit und Kulturorganisationen zuständig sein müssen, gerät ins Wanken. Andererseits gibt es derzeit keinen Ansatzpunkt für eine Neudefinition der Rolle von öffentlicher Finanzierung und der Verantwortung der Kulturpolitik. Aber hängt der Bestand von Kulturstätten allein von der öffentlichen Finanzierung ab? Muss man Kulturstätten zusperren, weil die Politik versagt und weil der Staat sich zurückzieht?
Neue Herausforderungen Für Kulturorganisationen
Ausgehend von meinen Eingangsthesen und den Erläuterungen möchte ich folgende Konsequenzen ableiten:
Zu These 1: Es kommt in der Kulturarbeit nicht nur auf die Höhe der öffentlichen Mittel und auf gute politische Rahmenbedingungen an, sondern auch darauf, wie gearbeitet wird (Qualität, Professionalität). Kulturarbeit ist auf Reflexionsfähigkeit und Professionalität angewiesen:
- Es geht heute weniger um die Vermehrung konsumierbarer Angebote, sondern um die Schaffung von Rahmenbedingungen und von Angeboten für kreative Prozesse, Eigenaktivitäten und Erfahrungen.
- Kulturarbeit braucht Klarheit über Rollen, Aufgaben und Funktionen ihrer Tätigkeit.
- Sie braucht Instrumente und Werkzeuge. Diese können die Arbeit erleichtern und ihre Qualität steigern.
- Kulturarbeit braucht angemessene Kriterien und Formen der Bewertung ihrer Qualität, ihrer Ergebnisse und ihrer Erfolge. Sie muss sie selbst entwickeln, sonst tun es andere. Die Bewertung für „Erfolg“ hängt in erster Linie von den Zielen ab.
- Kulturarbeit braucht Professionalität im Sinne von verbindlichen Standards und Kriterien für ein Arbeitsfeld und Berufsbild.
Zu These 2: Kulturorganisationen müssen aus ihren Erfahrungen im Umgang mit Organisationsstrukturen lernen. Einerseits gibt es normale Alterungsprozesse von Organisationen, andererseits Erfahrungen und Probleme, die für Kulturorganisationen typisch sind. Für Kulturorganisationen wird es überlebensnotwendig, Erfahrungen und Probleme zu reflektieren und daraus Konsequenzen zu ziehen:
- Der Betrieb von Kulturorganisationen ist mit klassischen Anforderungen verbunden: Wie andere Organisationen sind sie auf Führung und Entscheidungsfähigkeit sowie auf die Klarheit von Rollen, Funktionen und Aufgaben angewiesen.
- Für grundlegende Ansprüche und konstitutive Elemente von Kulturorganisationen wie zum Beispiel „Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen“, „Offenheit“, „Entwicklungs- und Neuerungsfähigkeit“ oder „Zielgruppenorientierung“ müssen geeignete Rahmenbedingungen und Maßnahmen getroffen werden. Sie müssen überprüft, sichergestellt, vielleicht auch reformuliert werden. Sonst stehen sie nur in den Statuten.
Zur These 3: Kulturinitiativen müssen ihr Selbstverständnis reformulieren und neue Strategien zur Sicherung ihrer Zukunft entwickeln. Sonst bleiben die Angebote, Qualitäten und Strukturen das Projekt einer Generation und sie werden verschwinden.
- Wenn bisherige Strategien (Forderungen an die Politik) in die Defensive geraten, hat es wenig Sinn, weiterhin auf gewohnte Argumentationsmuster zu setzen. Einerseits müssen Begründungen für die Notwendigkeit der öffentlichen Finanzierung von Kunst und Kultur erneuert und reformuliert werden. Andererseits müssen zusätzliche Strategien für die Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Sektors erarbeitet werden. Dabei kann sowohl von den Erfahrungen in anderen Ländern als auch aus anderen Non-Profitbereichen (Soziale Dienste, Umweltschutzorganisationen, NGOÕs) gelernt werden.
- KulturarbeiterInnen und Kulturorganisationen müssen als Teil eines dritten Sektors verstanden werden. Dazu zählen soziale Einrichtungen, Erwachsenenbildung, NGOÕs oder die Feuerwehr. Die Rahmenbedingungen für diesen Sektor hängen von einer Neudefinition der Rolle des Staates und der öffentlichen Finanzierung ab.
- Es braucht nicht nur eine Krisenstrategie gegen politisch motivierte Kahlschläge und Sparpakete, sondern auch eine Zukunftsstrategie, um mit den grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen wirkungsvoll umgehen zu können.