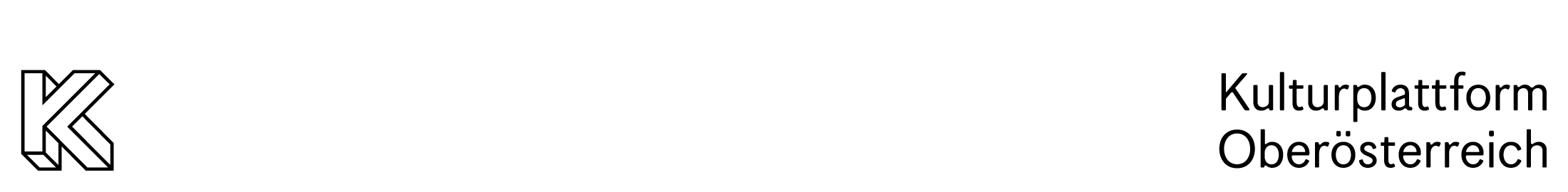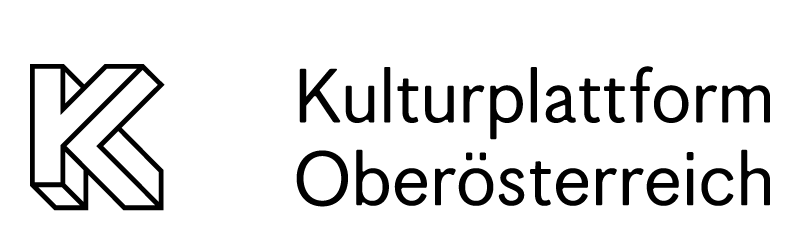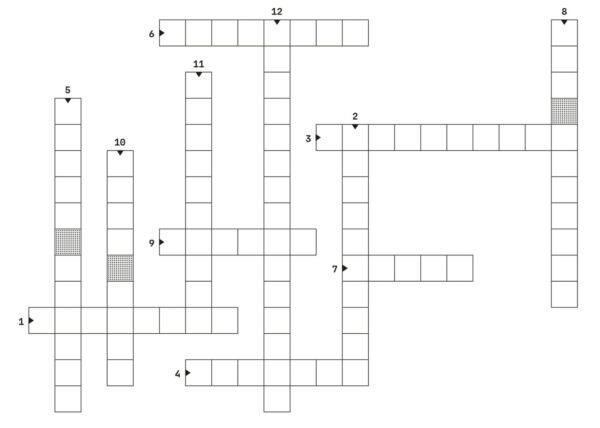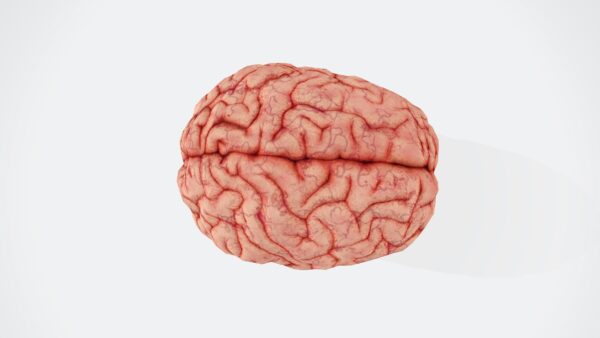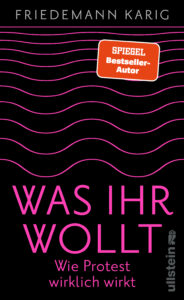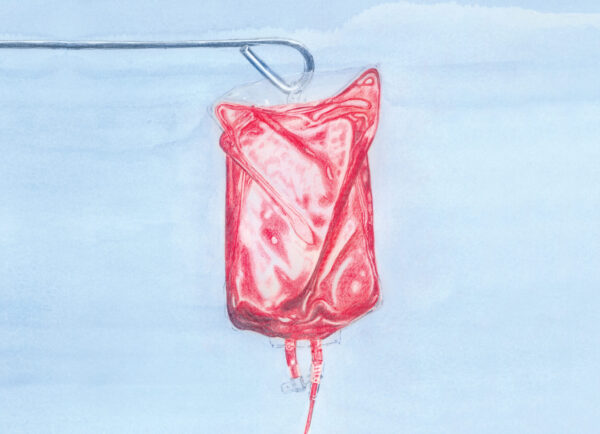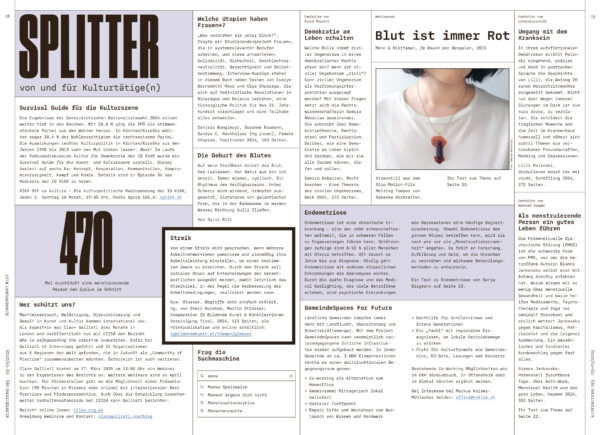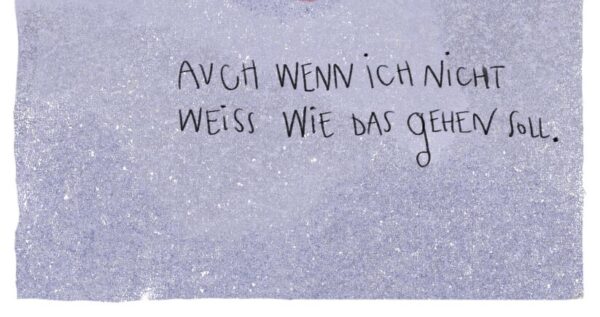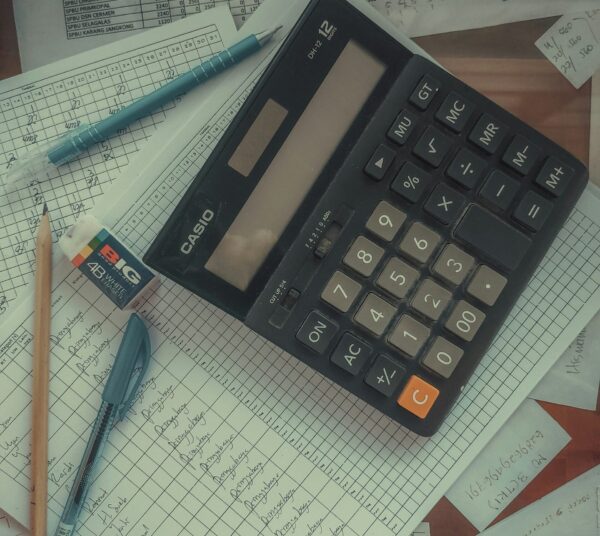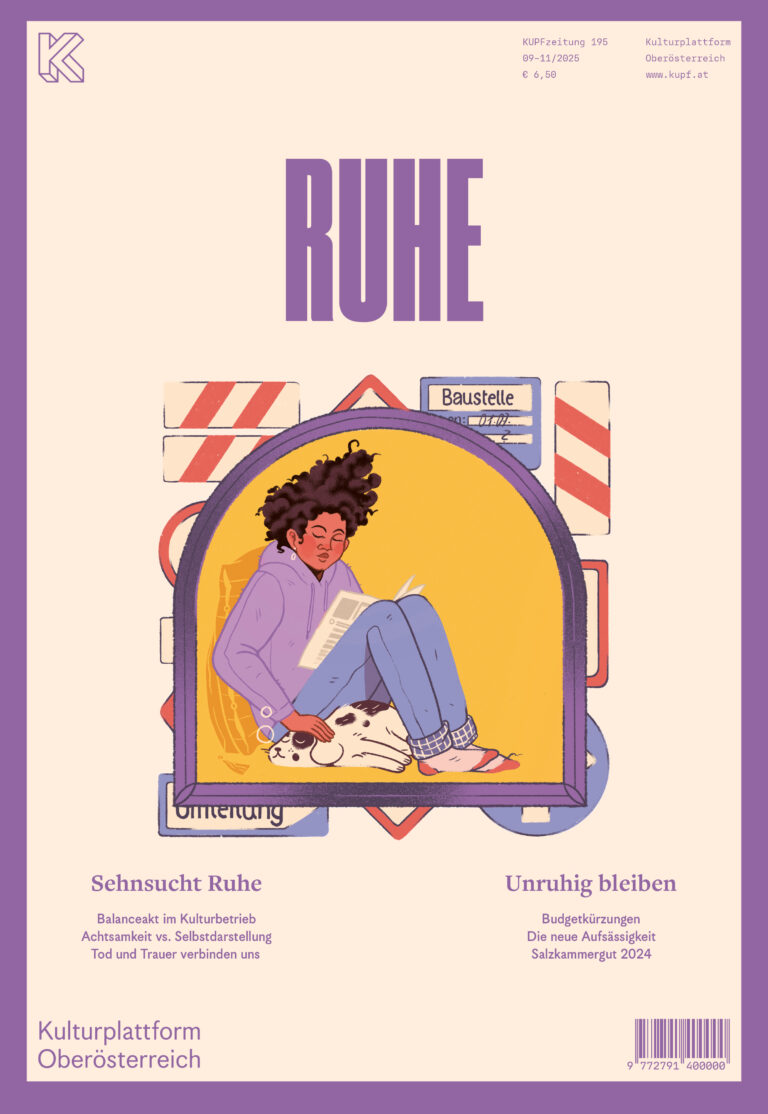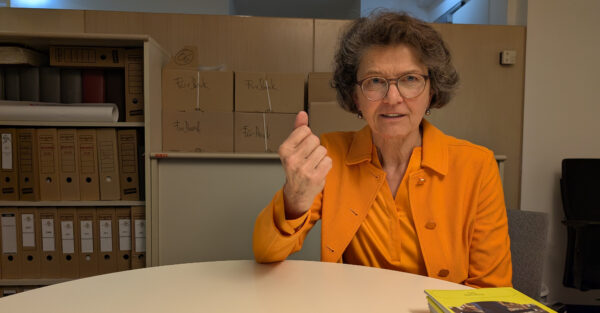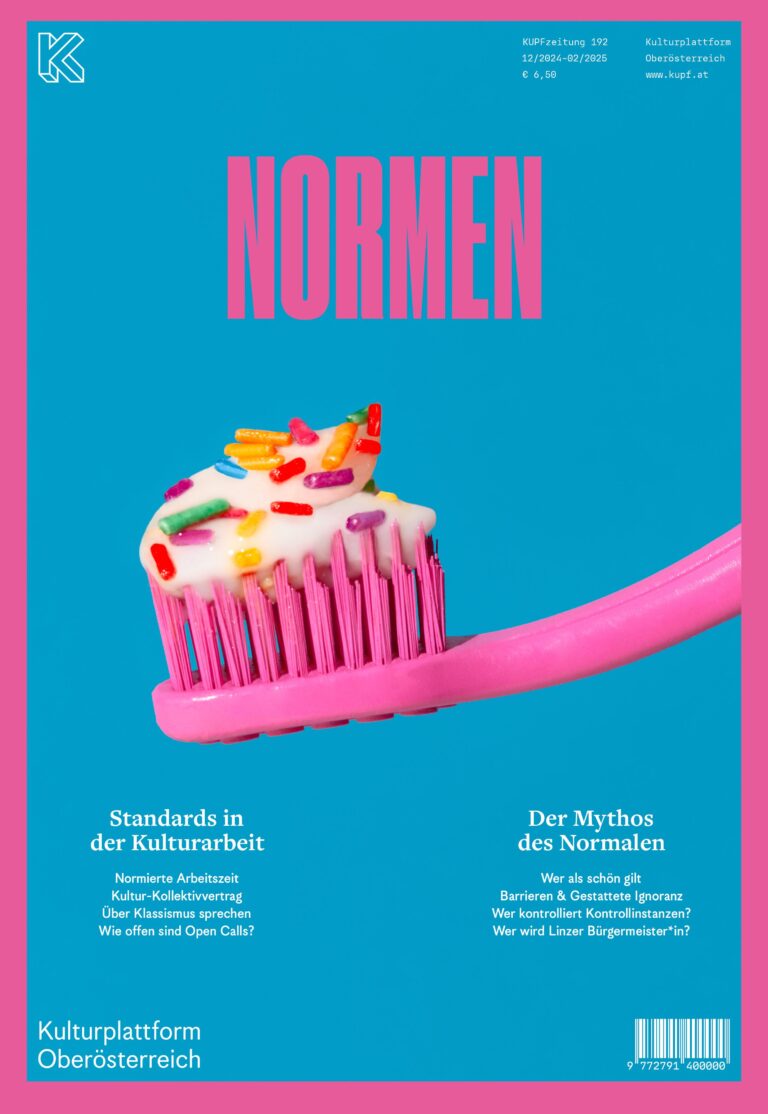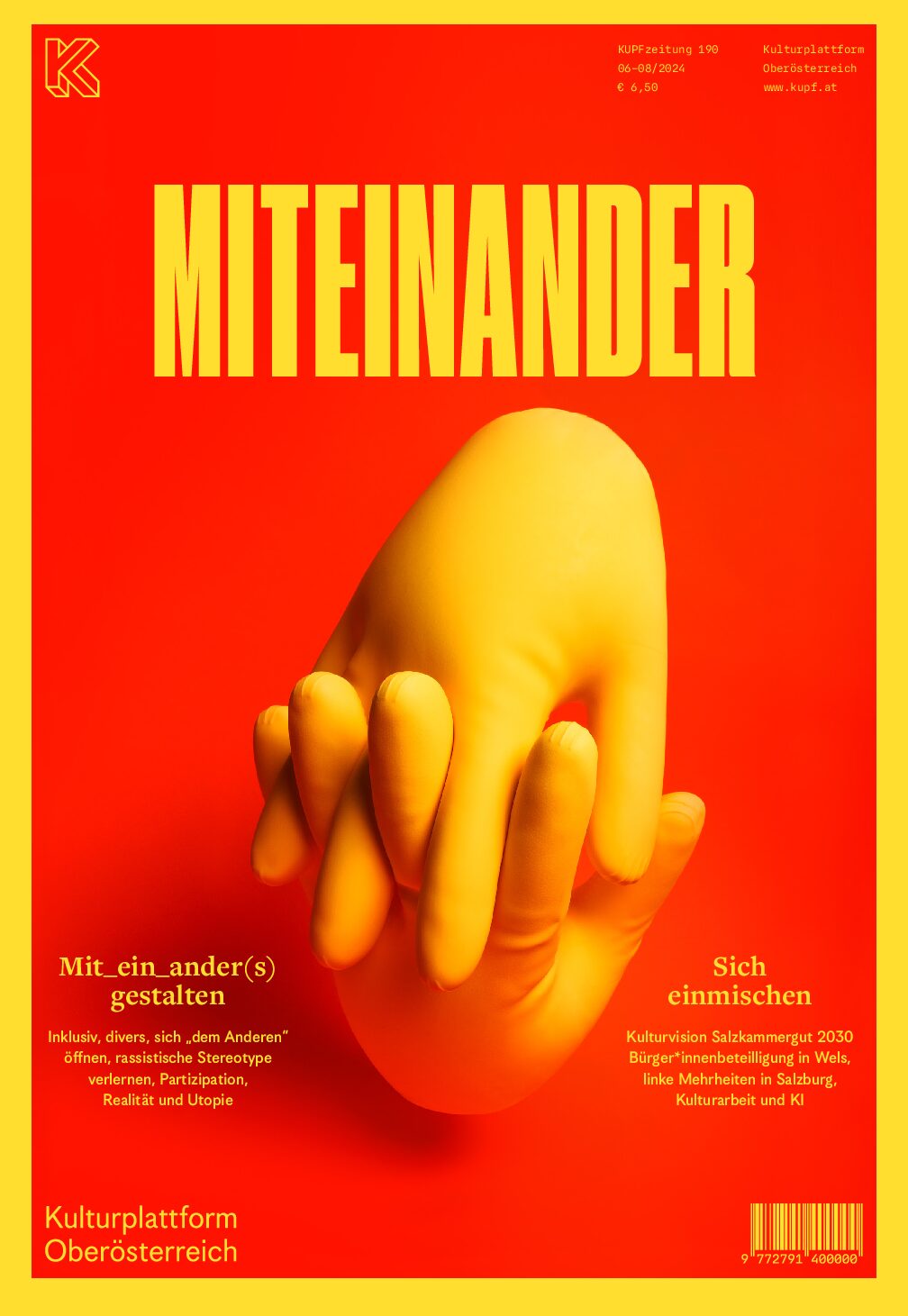Die eigene Heimatgemeinde ist für viele Vereine nicht nur Identifikationsquelle und Arbeitsmotiviation, sondern wichtige Partnerin für die Umsetzung der Kulturarbeit. Immer mehr Gemeinden können ihr Budget aber nicht mehr aus eigener Kraft ausgleichen. Was bedeutet das? Warum müssen Bund und Länder dringend handeln? Von Thomas Diesenreiter.
In Oberösterreich konnten letztes Jahr 140 der 438 Gemeinden ihr Budget nicht mehr aus eigener Kraft ausgleichen. Heuer werden es voraussichtlich deutlich mehr werden, manche Prognosen gehen von beinahe jeder zweiten Gemeinde aus, die als sogenannte „Härteausgleichsgemeinde“ enden wird. Das Problem ist dabei kein spezifisch oberösterreichisches: Auch aus den anderen Bundesländern hört man von immer mehr Finanzproblemen der Gemeinden. In Kärnten sind bereits zwei Drittel der Gemeinden zahlungsunfähig.
Eine neue Qualität hat in Oberösterreich dabei auch die Größe der betroffenen Gemeinden: Waren früher vor allem besonders kleine und strukturschwache Orte im Härteausgleich, trifft es mittlerweile immer mehr größere Gemeinden und sogar Bezirkshauptstädte. Ried im Innkreis geht beispielsweise heuer von einem Fehlbetrag von 6 Millionen € aus. Bei einem Gesamtbudget von 50 Millionen € eine riesige Summe. Auch Freistadt, Braunau, Eferding, Vöcklabruck oder Perg kämpfen laut Medienberichten 2025 massiv mit ihren Haushalten und können diese teilweise nur noch durch die Auflösung letzter Rücklagen ausgleichen. Spätestens 2026 drohen aber auch sie zu Ausfallsgemeinden zu werden.
Was bedeutet das konkret?
Der oberösterreichische Landtag hat unter dem Schlagwort „Gemeindefinanzierung Neu“ 2018 die Vergabe von Gemeindebedarfszuweisungen und Landeszuschüssen neu geregelt. Das umfangreiche Regelwerk sieht Regeln vor, welche Ausgaben eine Gemeinde, die im Härteausgleich gelandet ist, noch in welcher Höhe vornehmen darf. Grundsätzliche Stoßrichtung ist dabei eine Reduktion auf das „Notwendigste“, die Pflichtausgaben. Darunter fallen allerdings nicht die sogenannten Ermessensausgaben, also jene Ausgaben, die eine Gemeinde freiwillig tätigt. Und genau das sind in den allermeisten Fällen die Finanzierungsbeiträge an die Kulturvereine.
Fallen die Gemeinden als Financiers der ortsansässigen Kulturinitiativen aus, hat das verheerende Folgen: Freistadt musste binnen zwei Jahren die Ermessensausgaben von 450.000 € auf 150.000 € senken, das entspricht einer Kürzung um zwei Drittel. Die Folge: Die Local-Bühne Freistadt wurde schrittweise im letzten Jahr auf 50% und heuer sogar auf nur 25% ihrer bisherigen Finanzierung gekürzt. Der bisher zusätzliche Zuschuss für die Literaturtage Freistadt wurde gleich zur Gänze gestrichen. Auch alle anderen Sport- und Sozialvereine sind von Kürzungen in ähnlicher Höhe betroffen.
Auch das KiK Ried muss seit letztem Jahr zittern: Für 2025 muss der Verein die Streichung der gesamten Unterstützung der Gemeinde fürchten. Gleiches gilt für die Galerie 20ger Haus, genauso aber auch für die meisten örtlichen Sport- und Sozialvereine.
Laut einer Studie des Zentrums für Verwaltungsforschung sind es grob 10 Millionen €, die von den Gemeinden als Finanzierungsbeiträge an Kulturinitiativen und Künstler*innen gehen. Zum Vergleich: Die Ermessensausgaben für Kunst und Kultur des Landes OÖ summierten sich im Vergleichsjahr auf etwa 16 Millionen €. Fallen die Gemeinden also als Mitfinanziererinnen aus, fällt den Kulturvereinen ein beträchtlicher Teil der Einnahmen weg, mit drastischen Auswirkungen auf das Kulturangebot für die Bevölkerung.
Was muss nun passieren?
Die Gemeinden brauchen mehr Geld, so viel ist klar. Ein baldiger Wirtschaftsaufschwung wäre eine Lösung nach dem Prinzip Hoffnung, ein Aufschnüren des eigentlich bis 2028 gültigen Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist ebenso politisch unwahrscheinlich. In Oberösterreich wäre eine Entlastung durch das Land möglich, da dieses von den Gemeinden Transferzahlungen einhebt, deren Höhe es selbst festsetzt. Während sich aber das Land verschulden darf und daher zur Not niedrigere Transferzahlungen in Kauf nehmen könnte, steht diese Option bei den Gemeinden nur den drei Statutarstädten (Linz, Wels und Steyr) offen.
Eine Erhöhung der Gemeindesteuern wäre ein weiterer Weg. Die Anpassung der Grundsteuern wäre nach 40 Jahren eine Forderung, die nicht nur von vielen Kommunalpolitiker*innen aller Parteien als auch unabhängigen Expert*innen gefordert wird.
Kurzfristig ist aber vor allem die Kulturdirektion des Landes OÖ gefordert, jene Kulturinitiativen gezielt zu unterstützen, die in Härteausgleichsgemeinden liegen. Dafür wird es notwendig sein, deutlich über die bisherigen Förderquoten hinauszugehen und im Idealfall den Ausfall der Gemeinden zur Gänze auszugleichen.