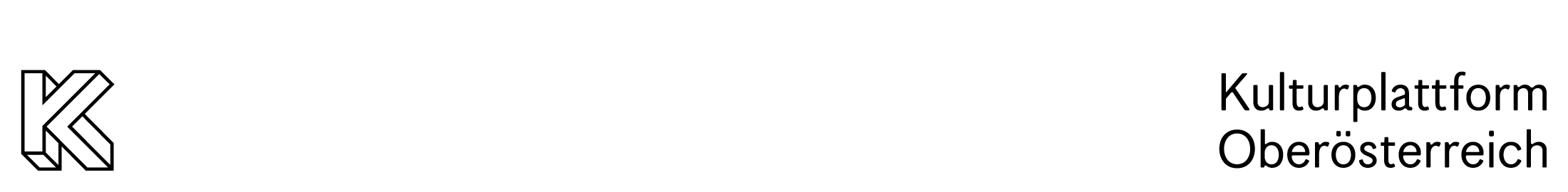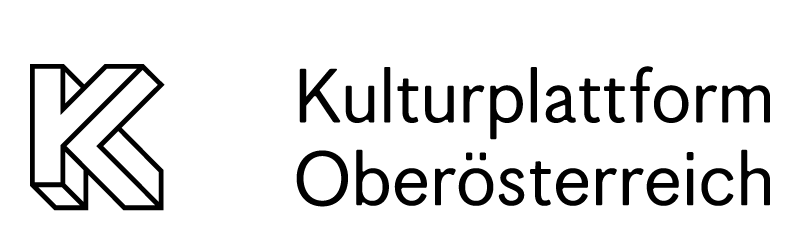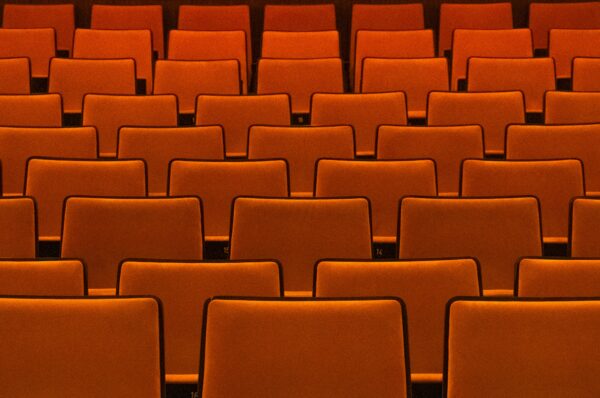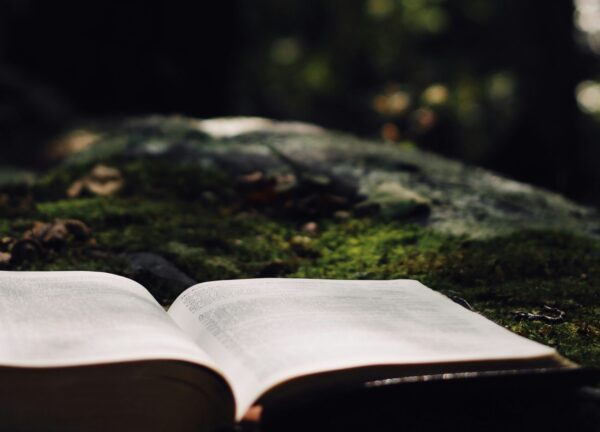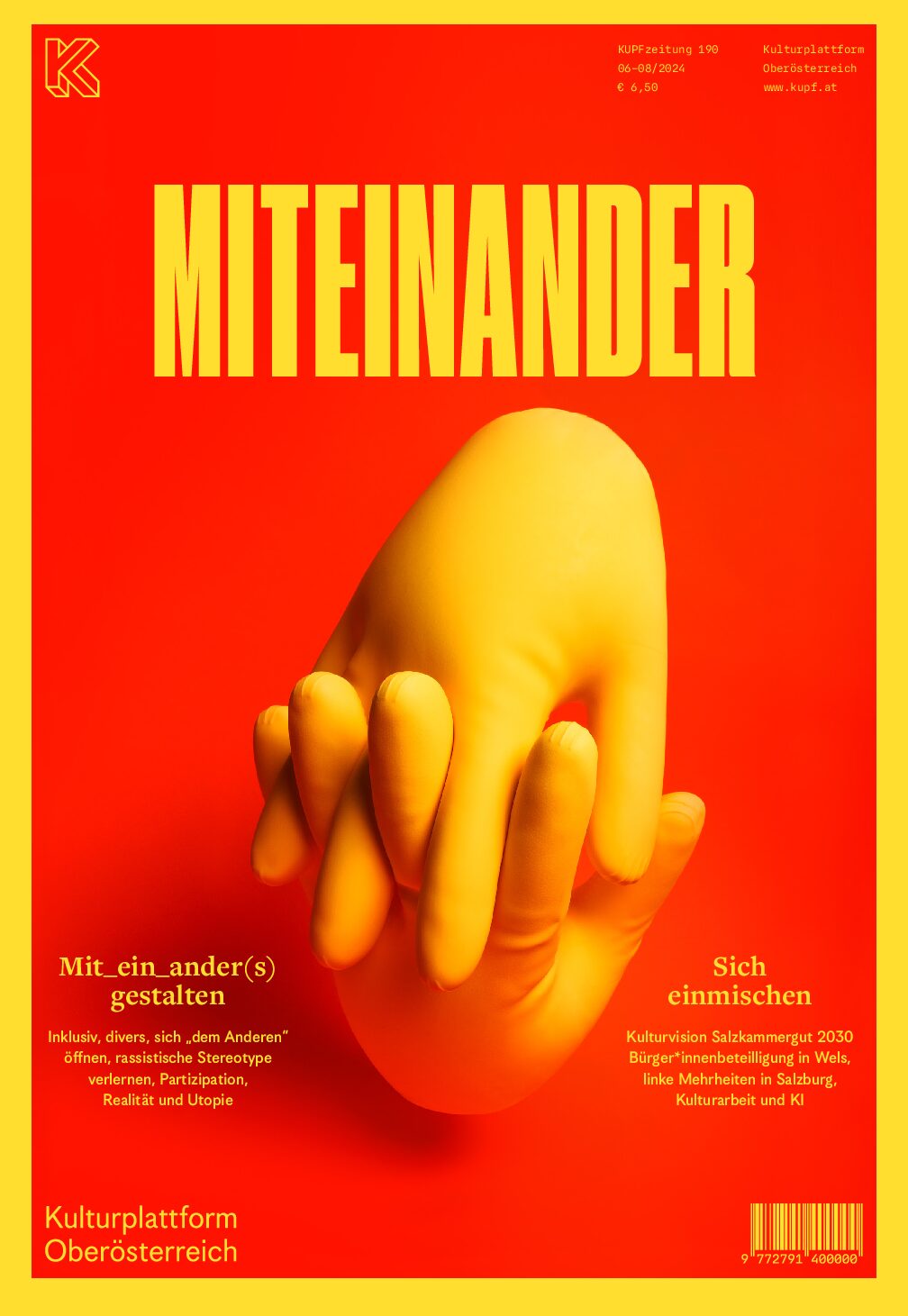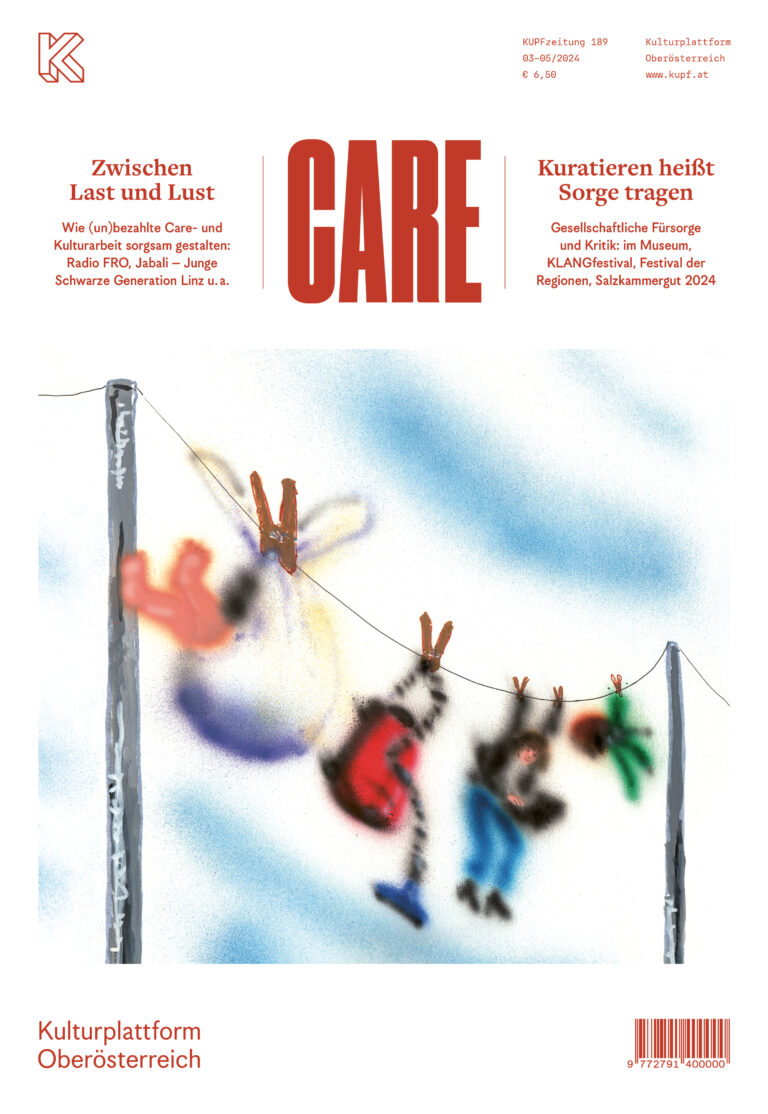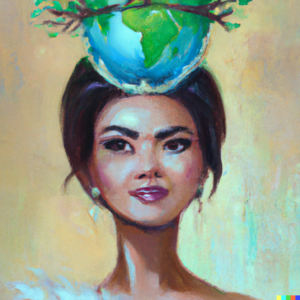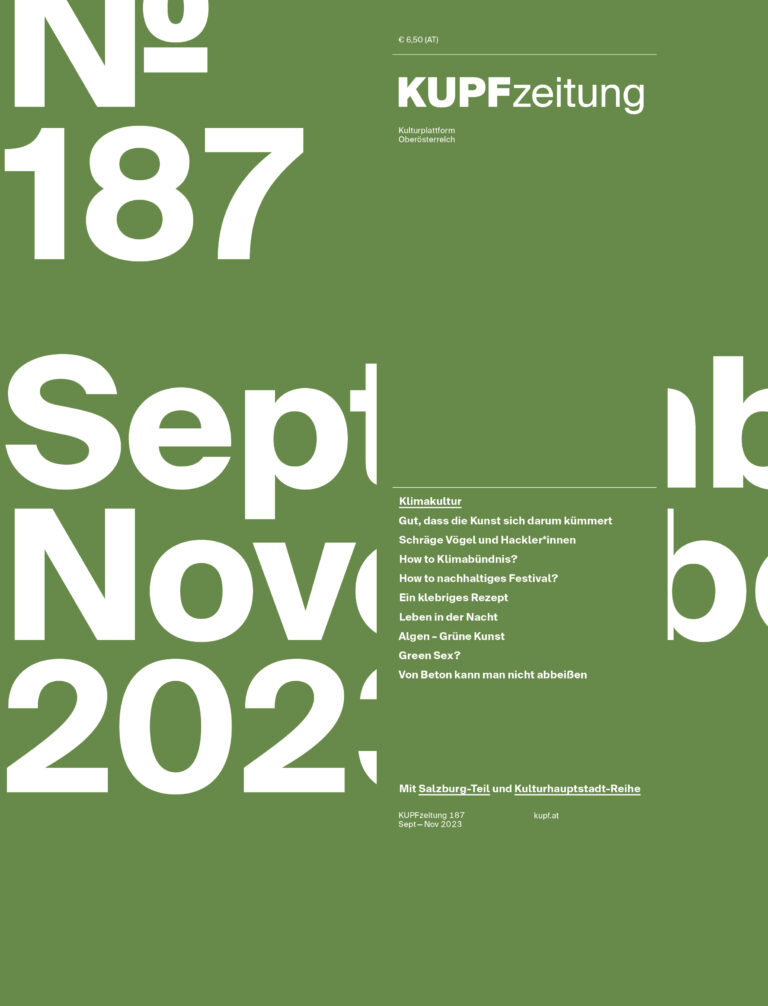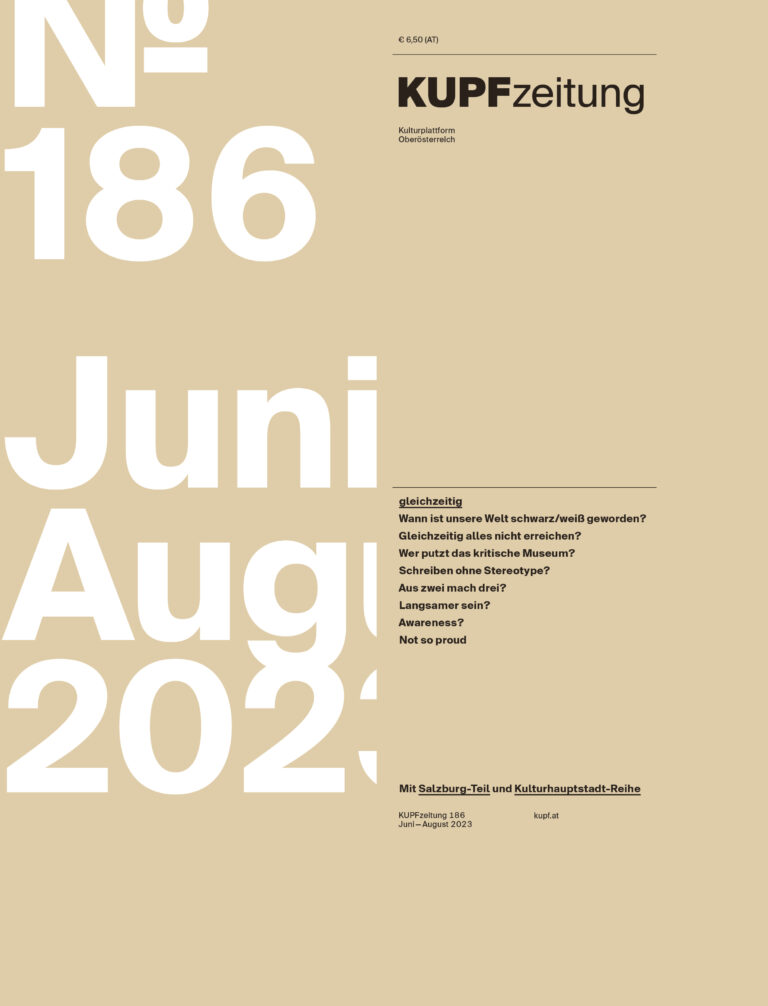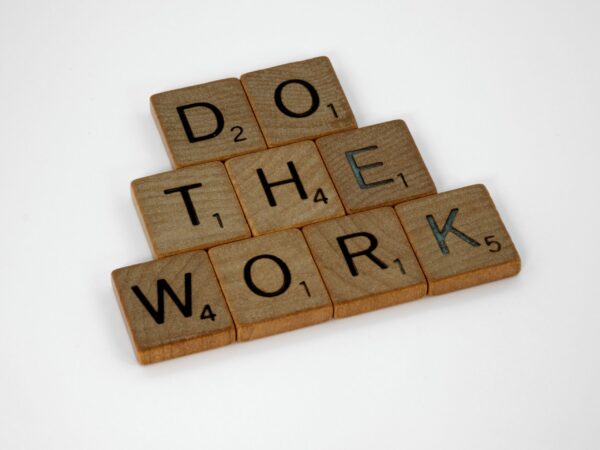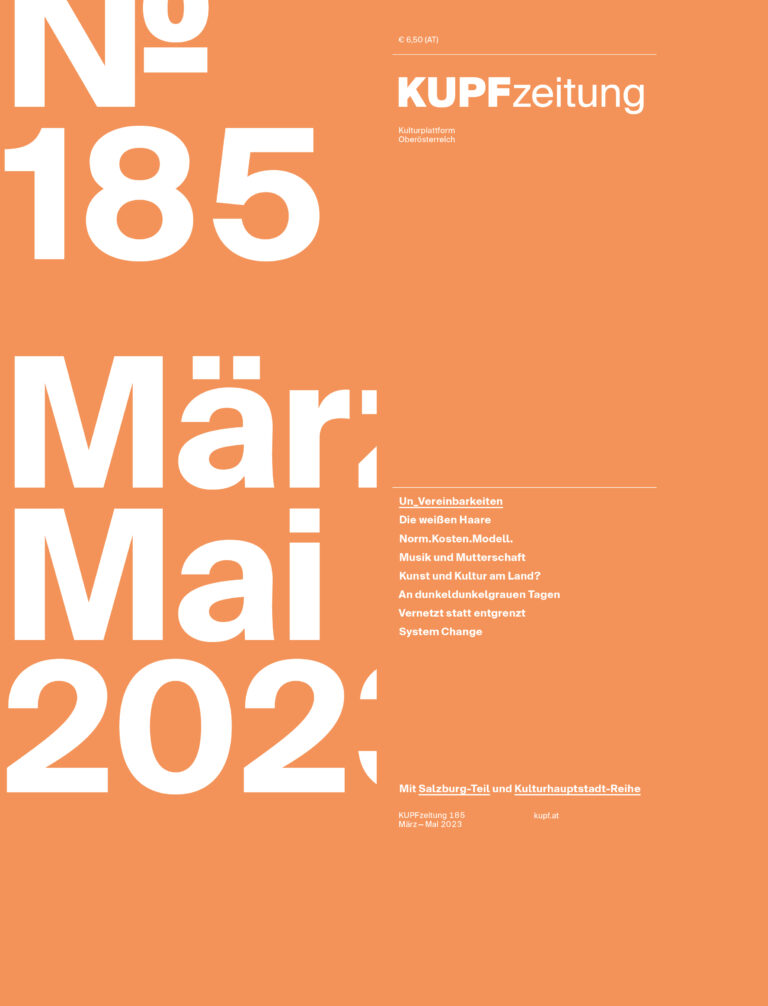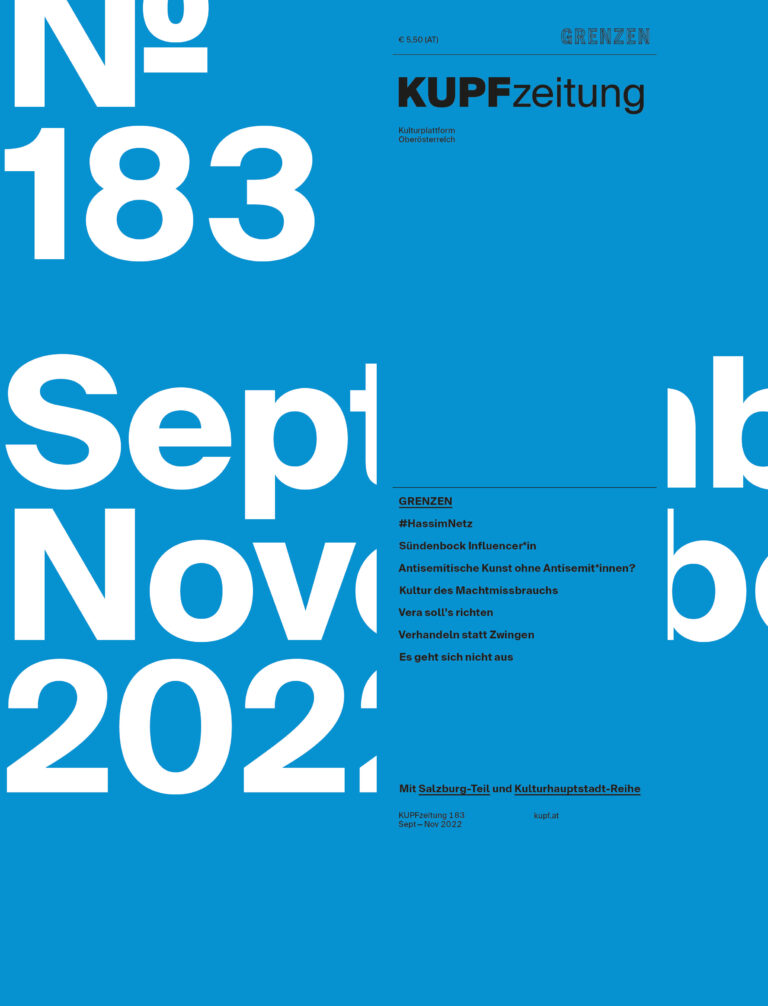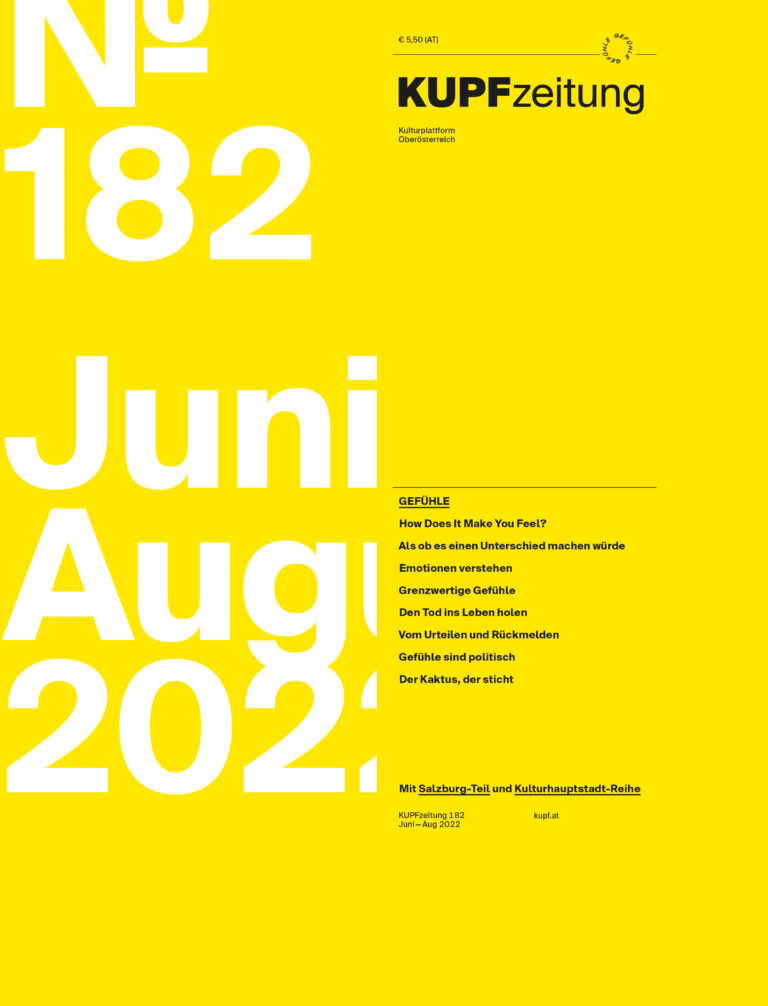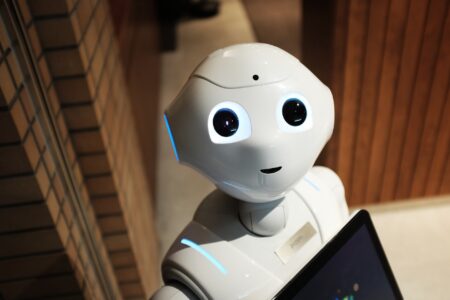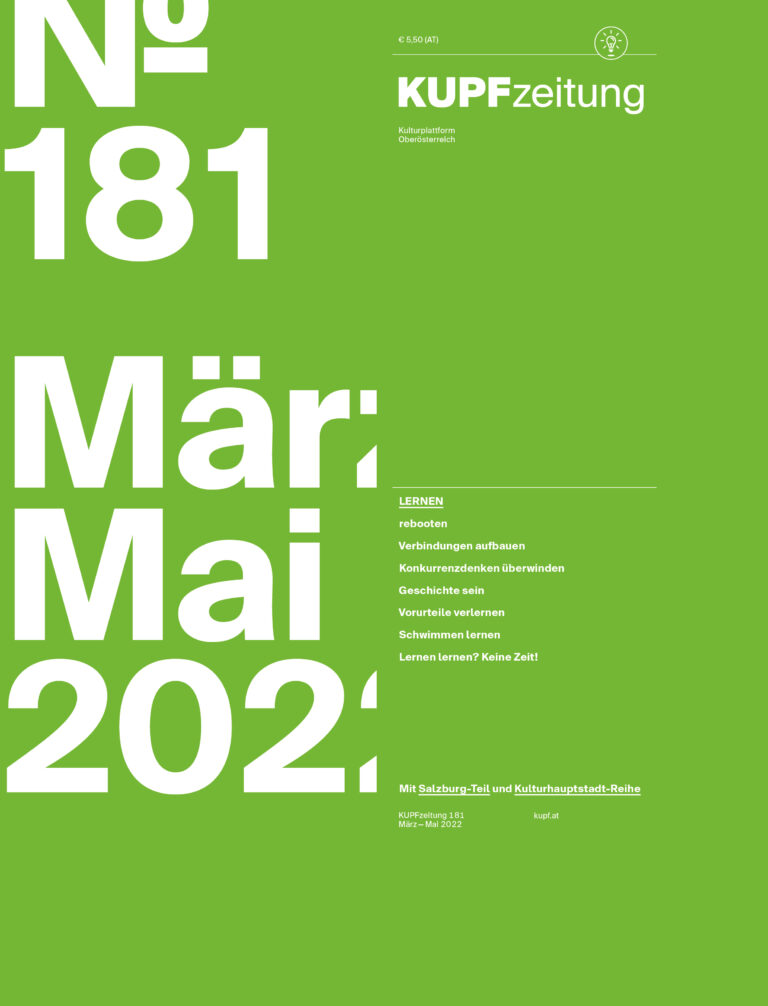Von der Sehnsucht nach dem faden Leben
Senf kommt aus Asien. Das war nie ein Geheimnis. Irgendwann kam er über Handelswege hierher – und blieb. Im Regal, am Tisch, neben Brot, Käse, Würsteln. Niemand fragte nach seinem Stammbaum, niemand zählte die Körner nach. Senf war da: mal geliebt, mal ignoriert, manchmal verspottet, wenn er zu scharf geriet. Aber er gehörte dazu.
Heute klingt das anders. Plötzlich stört er. Zu fremd, zu laut, zu gelb. Er verdecke den „ehrlichen“ Geschmack, heißt es. Passe nicht in die Küche von früher, wo alles noch so einfach war. Manche flüstern, er habe sich eingeschlichen – als hätte der Senf nachts heimlich Grenzen überquert. Also greift man lieber zum Kren: rein, heimisch, klar – sicher.
Und siehe da: Ein paar Stimmen reichen aus. Schon wird darüber geredet, ob man Senf nicht besser vom Tisch räumt. Man sagt, das sei ja nur eine Geschmacksfrage. Aber für die meisten ist klar: Ohne ihn bleibt das Essen fad. Ein Würstel ohne Senf ist bloß warme Wurst. Ein Brot ohne Senf klebt im Hals. Man kaut, hustet, trinkt Wasser – und sehnt sich nach der Würze, die man offiziell nicht mehr mag.
Das Muster ist alt. Nicht der Alltag bestimmt, was gilt, sondern die Lautstärke. Ein paar empören sich, und plötzlich tun alle so, als hätten sie sich schon immer gestört. Dass ihre Eltern Senf selbstverständlich verwendet haben, wird verdrängt. So wird aus Gewohnheit Verdacht, aus Selbstverständlichkeit Fremdheit.
Früher, sagen manche, sei alles besser gewesen. Aber früher war der Senf auch schon da, nur niemand fühlte sich bedroht.
Denn es geht nicht um Schärfe oder Süße, nicht um kulinarische Vorlieben. Es geht um Macht. Darum, wer bestimmt, was dazugehört und was nicht. Wer den Tisch deckt und wer wieder aufstehen soll. Dabei berauben wir uns selbst. Wir verlieren nicht nur Würze, sondern auch die Fähigkeit, Verschiedenes nebeneinander auszuhalten.