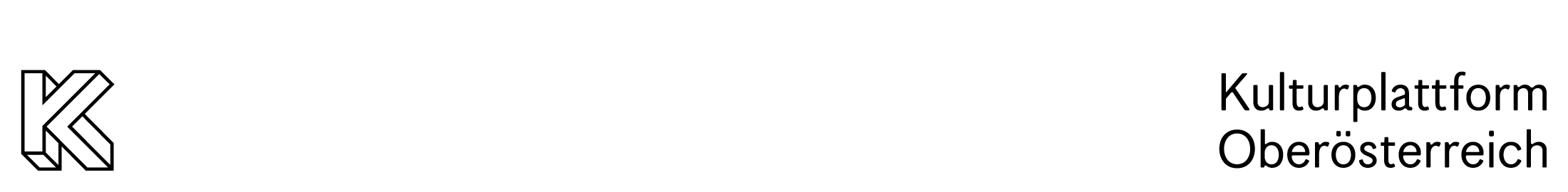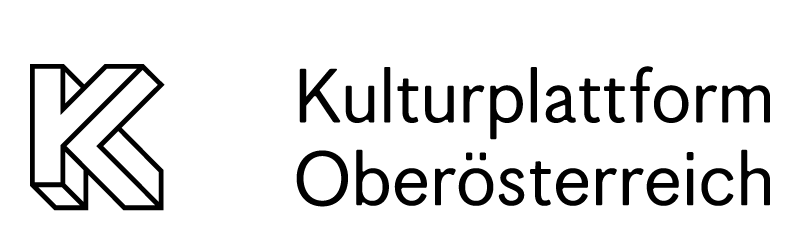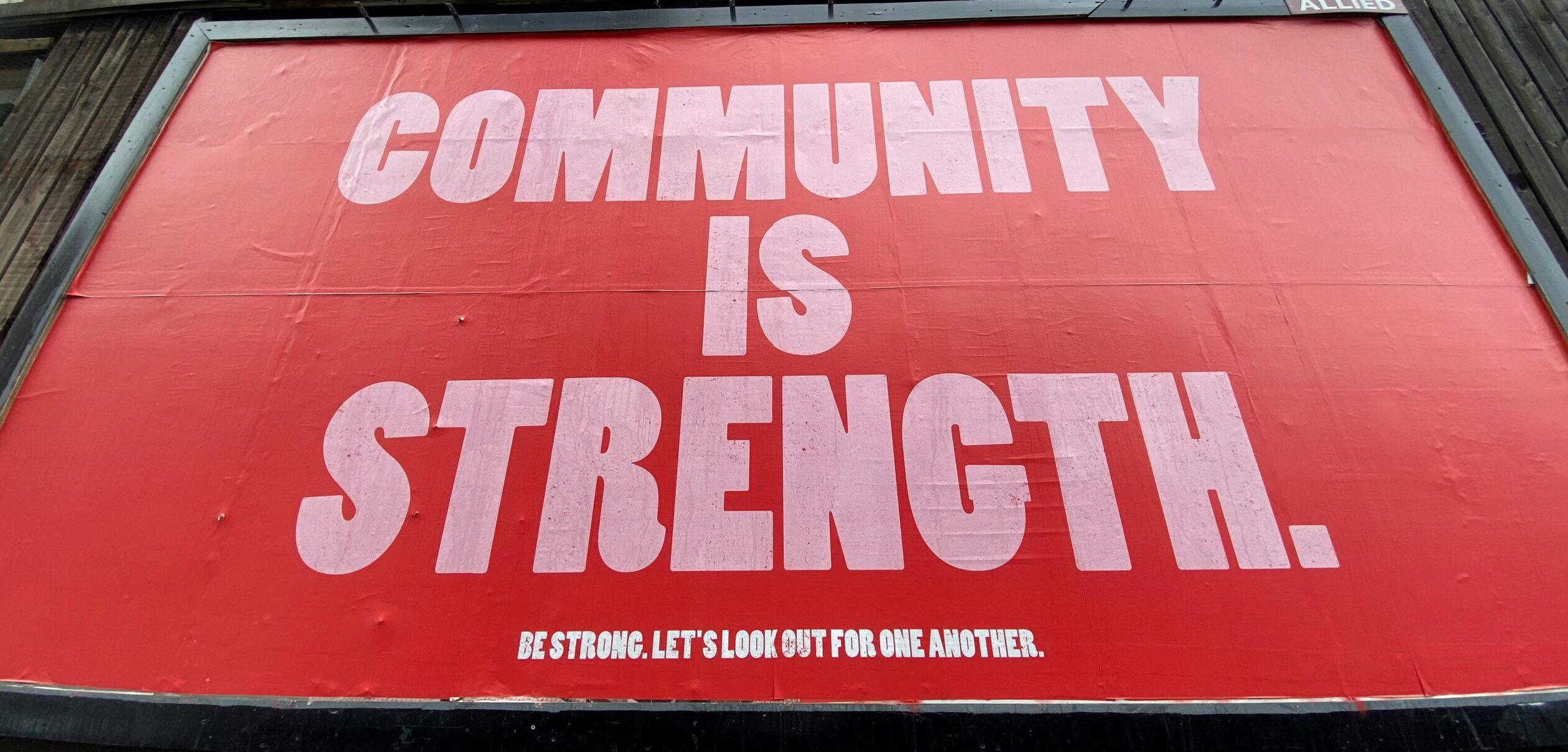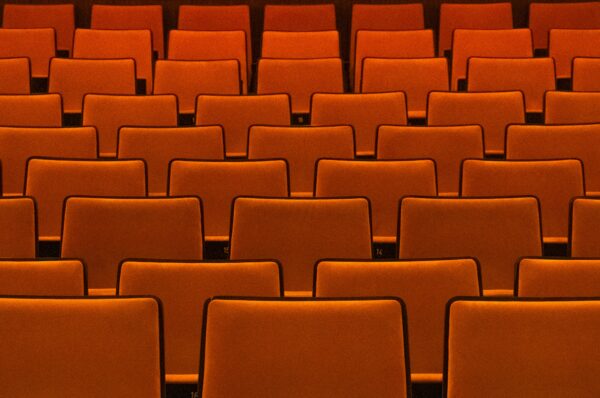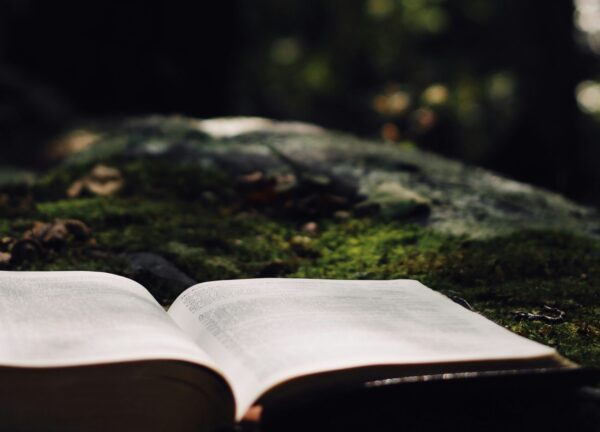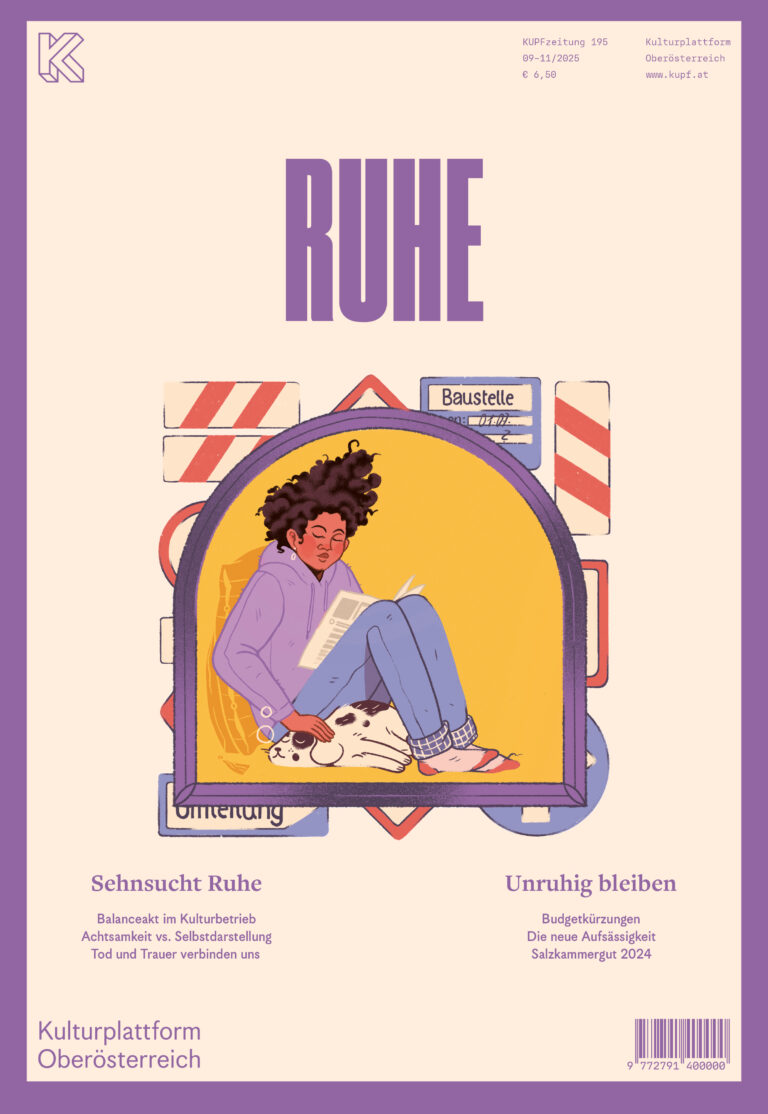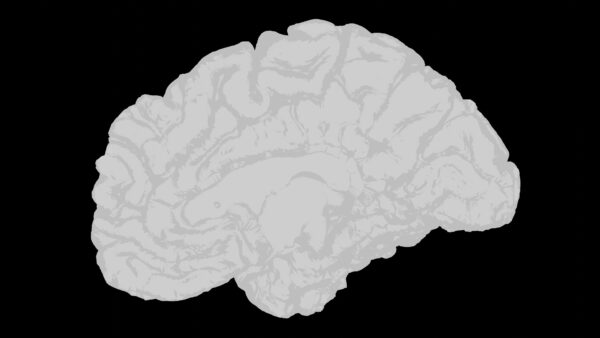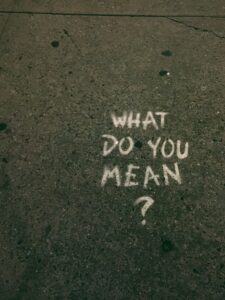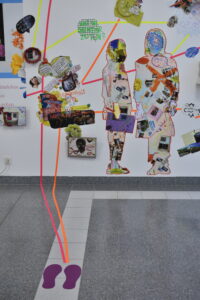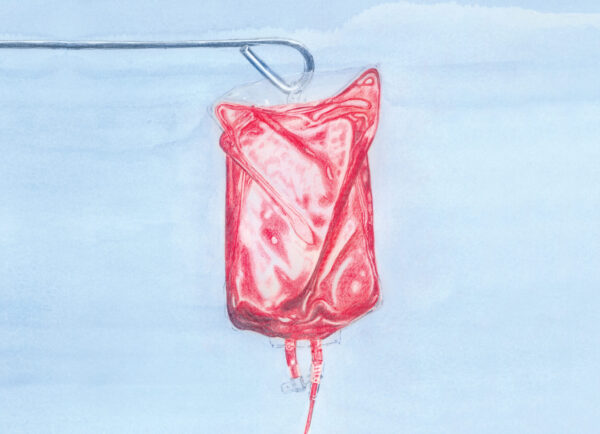Wie bindet man als Verein oder Institution das Publikum und Communities ein? Kinga Szemessy hat – in Austausch mit ihrer Kollegin Julieta Jacobi – 3 Fragen zu Community Outreach beantwortet.
Was ist Community Outreach?
Community Outreach ist das gestaltete Einbeziehen von Communities in Institutionen, Vereine, Museen, künstlerische und kulturarbeiterische Prozesse usw. Initiiert werden kann es sowohl durch äußere Zwänge, denen die Institution ausgesetzt ist, als auch durch deren eigene innere Motive. So wird etwa von Künstler*innen wie auch von Universitäten erwartet, eine Rolle in sozialem Wandel zu spielen und zu wirtschaftlichen Entwicklungen beizutragen – etwa als Reaktion auf eine alternde Bevölkerung, den Klimawandel oder ein wachsendes Misstrauen in die Legitimität und Unparteilichkeit (politischer) Expert*innen. Gleichzeitig erkennen viele Kunst- und Hochschuleinrichtungen ihre eigenen Mechanismen der Exklusion und wollen dem aktiv entgegenwirken. Hier ist es naheliegend, die Alltagsexpertise spezifischer Communities themenspezifisch einzubinden.
Was braucht es, damit sich Personen einbringen können?
Zugang zu Informationen, verfügbare Zeit, das Gefühl, nicht nur für symbolische Zwecke benutzt zu werden (als bloße Zahl in der Statistik zu dienen), und die Gewissheit, dass eigene Interessen richtig vertreten werden, sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass man sich engagiert und engagiert bleibt. Die erste Aufgabe der Institutionen besteht darin, radikal ehrlich zu prüfen, warum sie Community-Outreach- und Beteiligungsstrategien verfolgen und welche (finanziellen) Ressourcen sie dafür bereit sind zur Verfügung zu stellen. Auch um zu klären, ob sie als Community auftreten. Sind diese Punkte unklar, merken Menschen das meist schon an der Einladung, die sie erhalten.
Community Outreach ist meist die Voraussetzung für Community Engagement, wenn die Community sich proaktiv für diese Einbeziehung der Institution verpflichtet.
An wen richtet sich Community Outreach?
Outreach kann sich sowohl an die naheliegenden Communities richten (wie die Nachbarschaft, Studierende an einer Universität oder Künstler*innen in einem Theater oder Museum) als auch an jene, die bislang kaum präsent sind.
Wie hält man die Bindung zu Interessierten und ermöglicht gleichzeitig Zugänge für Neue?
Wie Kulturwissenschaftler Goran Tomka argumentiert, lässt sich Community-/Publikumsengagement nicht nur auf spezifische Veranstaltungen begrenzen, sondern als übergreifende institutionelle Praxis denken. Das Management von Beziehungen kann vielfältig erfolgen: durch ermäßigte Tickets, das Anbieten von Räumen für bereits laufende Initiativen (z. B. Lesekreise), community-based ko-kreative künstlerische Prozesse, aber auch durch Personalgewinnung sowie die partizipative Programmplanung der nächsten Theaterspielzeit oder des Kursangebots eines Fachbereichs. Eine gegenseitig vorteilhafte, vertrauensvolle Verbindung und ein Gefühl von Kontinuität sind dafür unerlässlich. Es gibt hierfür keinen universellen Ansatz (und sollte es auch nicht geben); am nachhaltigsten ist Engagement dann, wenn sich eine Community ausreichend handlungsfähig, selbstermächtigt und der Institution verpflichtet fühlt, um neue Mitglieder selbst einzuladen und deren Ankommen zu erleichtern.
Lesetipps & Referenzen:
Community engagement in higher education – Trends, practices and policies – NESET Analytical Report, Publications Office, Luxembourg: 2020, data.europa.eu/doi/10.2766/071482
Kulturkompass für Europa Unterlagen (z. B. EU Work Plan for Culture) culture.ec.europa.eu/policies/culture-compass-for-europe
Tomka, Goran, Audience engagement as practice: From extraordinary to everyday, Journal of Cultural Management and Policy, 2024. No. 1.