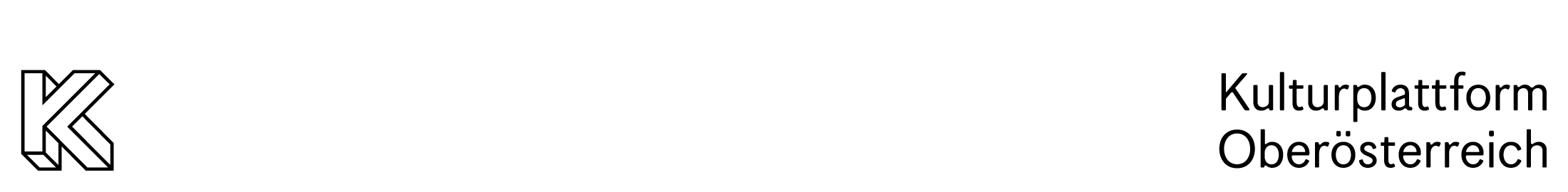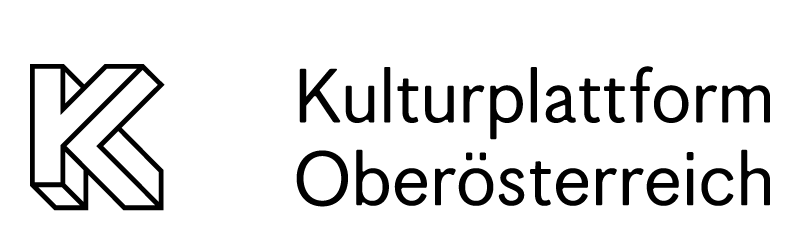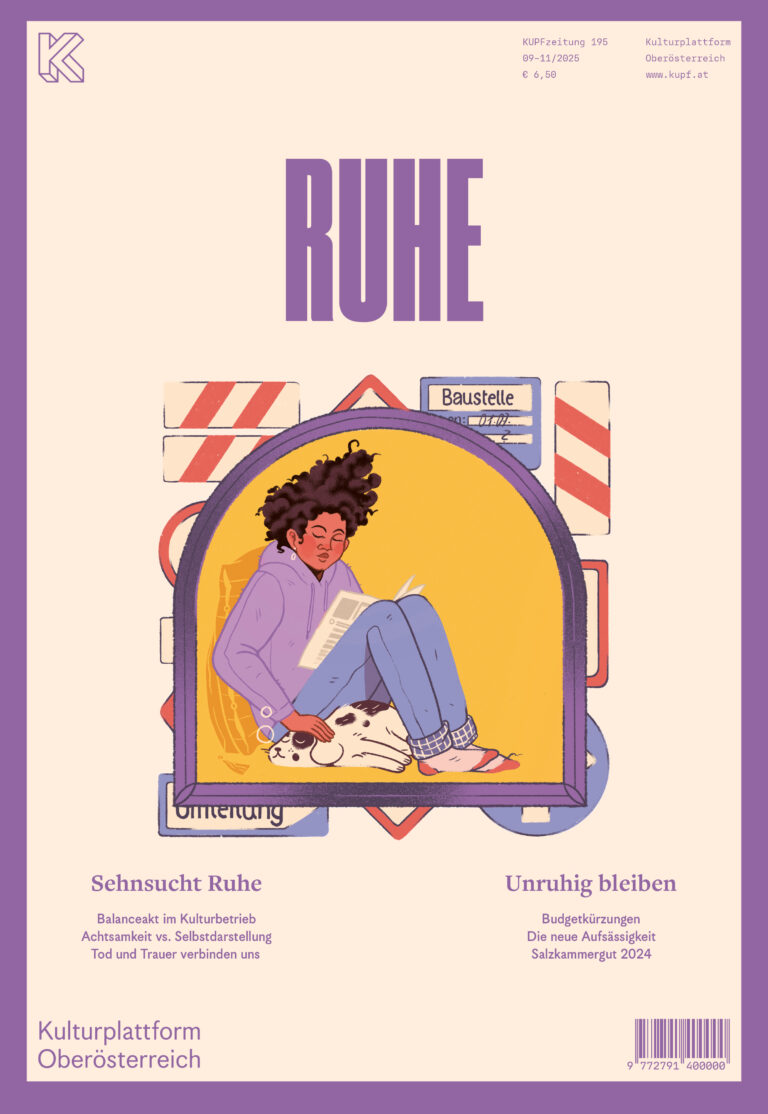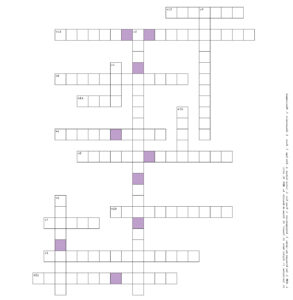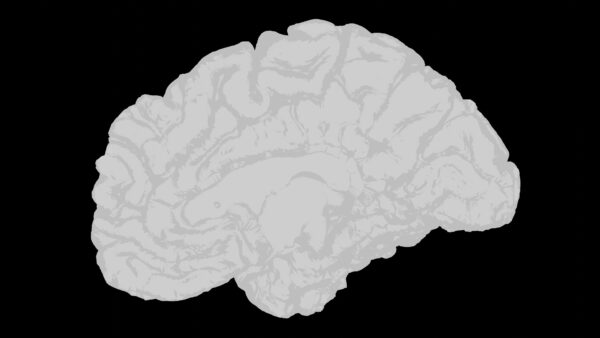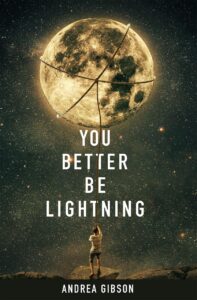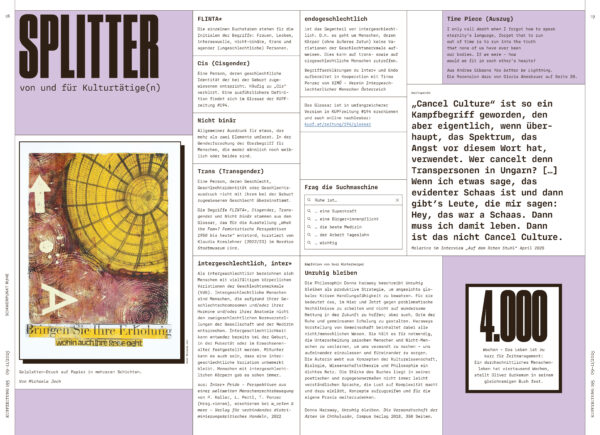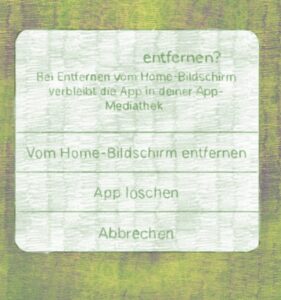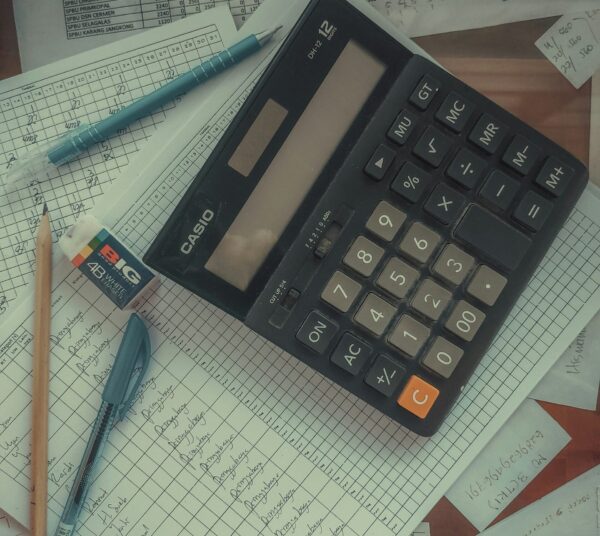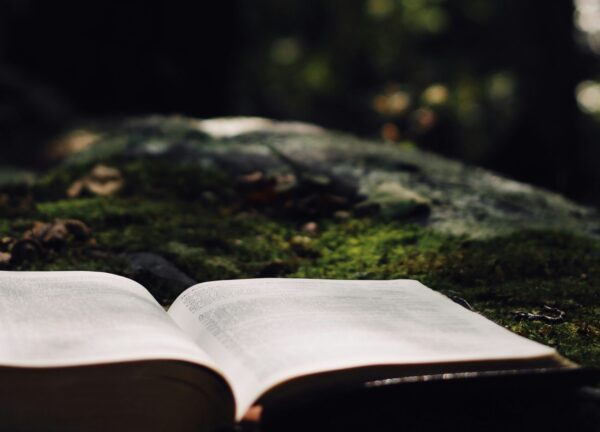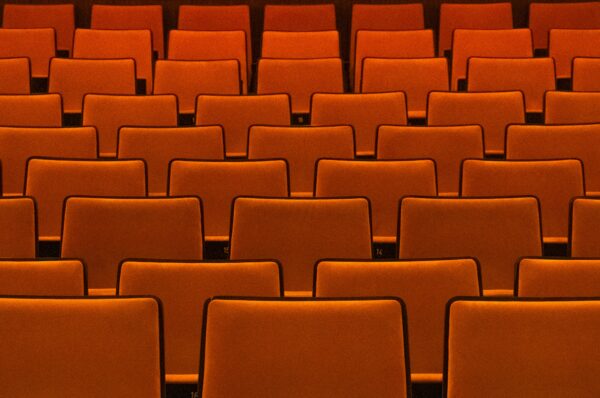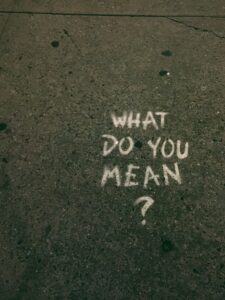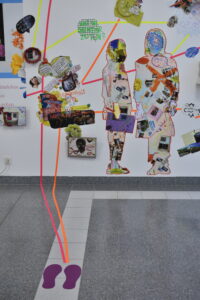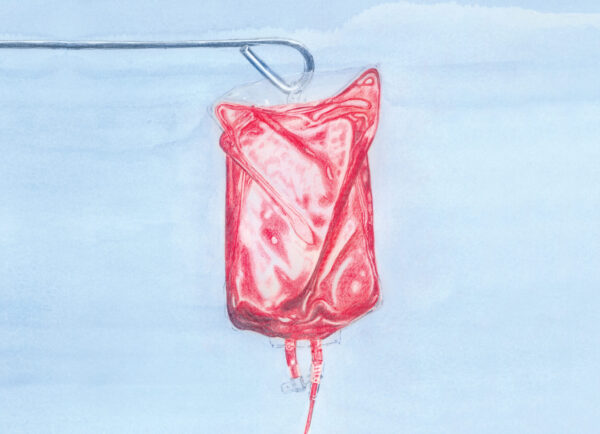Wir hetzen durch Museen, Theater und Festivals, ohne sie wirklich in der Tiefe zu erleben. Wie ginge das auch anders? Von Hannah Stuck.
Waren Sie schon einmal im Louvre? Ich war damals als Schülerin dort und konnte im Gedränge ein Selfie vor der Mona Lisa ergattern. Heute erinnere ich mich an nicht ein weiteres Kunstwerk dort, obwohl ich darauf bedacht war, keinen der vielen Ausstellungsräume zu verpassen.
Mein Louvre-Besuch ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Kunst und Kultur nicht erleben sollte: in Unruhe. Gleichzeitig verändert sich die Branche immer mehr in diese Richtung. Museumsbesuche erzeugen Unruhe, da man sie oft nur mit festen Zeitslots buchen kann – ein Verknappungsmechanismus, der den Zugang einschränkt und so Druck erhöht, alles erleben zu müssen. Pop-up-Galerien verstärken dieses Gefühl, da sie meist nur für wenige Tage geöffnet sind. Ganz zu schweigen von Musikfestivals, bei denen mehrere Künstler*innen nacheinander und parallel auftreten.
Dieses Phänomen betrifft nicht nur jene, die Kunst und Kultur konsumieren, sondern vermutlich im Besonderen die, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind. Der Spielplan des Theaters soll schließlich gut gefüllt sein. Horrende Mieten für Atelierräume wollen auch irgendwie bezahlt werden.
Kunst und Kultur als Produkte konsumieren
Diese Schnelllebigkeit führt schließlich dazu, dass Kunst heutzutage oft eher produziert wird als in einem freien kreativen Prozess zu entstehen – und dass ich durch ein Museum laufe, ohne mich umzusehen. Dem Soziologen Hartmut Rosa zufolge hat diese zunehmende Unruhe vor allem eins zur Folge: Entfremdung. Bezogen auf Kunst und Kultur meint dies, vermehrt die Fähigkeit zu verlieren, uns von Werken und Räumen wirklich berühren zu lassen. Sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrem Erleben fehlt es immer mehr an tiefer Verbindung. An Ruhe. Aus dem In-Beziehung-Gehen mit einem Kunstwerk wird das Konsumieren eines Objekts. Es geht aber noch sinnentleerter: ein Beispiel dafür ist die Einlagerung von Kunstwerken in Hallen zur Wertsteigerung. Dabei werden Kunstwerke ihrem eigentlichen Sinn gänzlich entzogen, niemand schaut sie dort mehr an. Diese Praxis der Beziehungslosigkeit ist in Kreisen der Superreichen Gang und Gäbe.
Prozesse und ihre Bedingungen
Letztendlich macht dies aber nur deutlich, unter welchen Bedingungen Kunst, Kultur und die zugehörigen kreativen Prozesse zu bestehen versuchen. Sie haben ein ökonomisches Problem. Das Theater hat nunmal Premierendruck, denn nur der gut gefüllte Spielplan spült genug Geld in die Kassen. Diesen Fertigstellungsdruck verspüren auch jene Künstler*innen, die ihre Atelierräume nur zahlen können, wenn Aufträge verkauft wurden. Künstler*innen, die auf ihre Onlinepräsenz angewiesen sind, unterliegen dem unerbittlichen Diktat des Algorithmus – von der Konkurrenz der KI, beispielsweise in der Musikbranche,ganz zu schweigen.
Wettbewerb, Preis- und Leistungsdruck als Mechanismen – kurz: Unruhe – zehren sowohl an Kunst- und Kulturarbeit als auch am Erleben dieser. Dennoch lassen sie sich nicht einfach aushebeln. Es muss also darum gehen, einen gesunden Umgang mit ihnen zu etablieren. Um sicherzustellen, dass wir uns weiter gegenseitig berühren.
Nicht alles sehen, aber dafür etwas fühlen wollen
Hartmut Rosas Antwort auf diese ungesunden Mechanismen, die seiner Beobachtung nach in allen Lebensbereichen wirken, ist Resonanz. Er versteht Resonanz als ein Schwingen mit der Welt, ein In-Beziehung-Sein und Antwortgeben. Laut Rosa hätte ich damals einfach nicht versuchen sollen, alle Räume im Louvre abzulaufen, nur um sagen zu können, alles gesehen zu haben. Ich hätte mir Zeit nehmen sollen, die ausgestellten Werke länger und in Ruhe auf mich wirken zu lassen, auch auf die Gefahr hin, am Ende ohne das Mona-Lisa-Selfie dazustehen. Ich hätte wahrscheinlich sogar die Räume mit den für mich besonders bewegenden Werken zweimal aufsuchen sollen und andere gar nicht. Dafür wäre ich vermutlich inspiriert und erfüllt aus dem Museum gekommen anstatt überreizt und gehetzt.
Wenn wir resonieren, schaffen wir eine gewisse Distanz zu diesen äußeren Mechanismen und ermächtigen uns selbst, bewusst zu fühlen – also in einen Dialog mit der Welt zu treten – und dadurch Ruhe zu finden. Kunst und Kultur resonant zu (er)leben emanzipiert unsere innere Ruhe gegenüber der Unruhe der Außenwelt.
Also warum nicht auf dem Festival einfach treiben lassen, anstatt den angesagten Musiker*innen hinterher zu jagen? Warum nicht auf ein Festival fahren, wo man niemanden auf dem Line-Up kennt? Warum nicht dasselbe Theaterstück zweimal ansehen? Warum nicht die Spielzeit dieses Stücks verlängern, wenn die Leute schon zweimal kommen? Warum nicht durchs Louvre spazieren ohne die Mona Lisa zu sehen?